»Vielleicht kommen die Roboterlehrer doch nicht«
Von der Bildungsmisere zu anfänglichem Nachdenken über eine mögliche Pädagogik der Zukunft (Spoiler: Es wird keine Tech-Utopie!) - Teil 1/X
Es gehört zu meinen exzentrischen Ansichten, dass wir in unser Kultur bei fast allem das Falsche machen — und dies dann auch noch auf falsche Art und Weise.
Für manche Phänomene ist dies zumindest in manchen Kreisen durchaus eine Mainstream-Meinung. So ist vielen bewusst, dass wir nicht nur das Falsche essen, sondern auch auf falsche weise; dass wir uns falsch bewegen und atmen; dass wir falsch schlafen; dass wir falsch wohnen; falsch ausscheiden; und so weiter…
Dass wir falsch lesen ist eine These, die ich kürzlich in einem Artikel expliziert habe. Auch dass wir falsch arbeiten, kam schon vor. Zudem könnte man vermuten, dass wir falsch mit anderen Menschen interagieren: falsch lieben, falsch Freundschaften führen — oder eben nicht führen —, uns falsch beim Bäcker und auf der Autobahn verhalten; falsch gegenüber den Fremden und den Bedürftigen.
Man könnte mit Adorno vermuten, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann, und dass es nur folgerichtig ist, dass wir alles falsch machen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in einer Kultur, die auf falschen Vorstellungen beruht. Wir denken falsch, über das Falsche, auf die falsche Art.
Daraus resultierend fühlen wir auch falsch, und wollen natürlich das Falsche.1
Sind die Schulen noch zu retten?
Ein Bereich, in dem wir meiner bescheidenen Ansicht nach auch so viel falsch machen, dass selbst das Gegenteil davon immer noch falsch wäre,2 ist die Schule. Ich vermute, das Konzept der Schule ist so unrettbar in falschen Vorstellungen verstrickt, dass man sie eigentlich abschaffen und von Grund auf die Bildung unserer Kinder neu denken müsste.
Vielleicht bin ich diesbezüglich aber zu pessimistisch. Ich will den Versuch wagen, mich einmal intensiver damit zu beschäftigen, was für Ideen im Raum stehen zur Reformierung. Mittelfristig schwebt mir vor, selbst ein Buch zum Thema Pädagogik zu schreiben, bei dem ich versuchen werde, aus Iain McGilchrists Hemisphären-Theorie Vorschläge für die Pädagogik herzuleiten.
Zunächst bin ich aber erst einmal in die Pädagogik-Abteilung der örtlichen Bibliothek gegangen, um zu sehen, was es so zum Thema schon zu lesen gibt. Ich erntete drei Bücher:
Richard David Prechts Anna, die Schule und der liebe Gott: Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern (2013)
Gerald Hüthers #Education for Future: Bildung für ein gelingendes Leben3 (2020)
Alex Beards Wie Kinder gerne lernen: Internationale Konzepte für eine Schule der Zukunft (2019)
Die Bücher ähneln sich in ihrer Zielsetzung. Sie gehen davon aus, dass unser Bildungssystem nicht zur Zeit passt, benennen Gründe und suchen Möglichkeiten, die Zukunft der Bildung positiv zu gestalten. Precht spricht von einer “Bildungskatastrophe”, auf die eine “Bildungsrevolution” zu folgen habe; Hüther et al. ganz ähnlich vom “Ende von Schulen, wie wir sie kannten”, auf die “Der Anfang von Bildung fürs Leben” folgt; und Beard, der sich als Angelsachse natürlich weniger präzise und explizit ausdrückt, spricht schlicht davon, neu zu denken, es besser zu machen und sich zu engagieren, benennt in seiner Einleitung aber auch recht deutlich das Ziel einer Transformation der Bildung.
Aus mir selbst nicht mehr ganz nachvollziehbaren Gründen4 beschloss ich, mich zunächst dem letztgenannten Buch zu widmen. Hier folgt nun, was ich bisher herausgefunden habe, was Beard will.
Eine Menschheit von Philosophen
Beard vergleicht die ursprüngliche griechische (platonische) Akademie mit dem modernen Academy-Begriff, der in Großbritannien Schulen bezeichnet, die speziell förderbedürftige Kinder auf ein höheres Niveau heben sollen. Seine eigene Erfahrung an einer solchen Schule bildete den Start seiner Karriere als Lehrer und Bildungsforscher — er war ernüchternd.
Seine Schüler lernten nicht freiwillig und nicht genug, und Beard hatte keine Ahnung wie er daran etwas ändern könnte. Womit er nicht alleine ist: viele Lehrer und noch mehr Eltern stehen vor dem selben Problem. Beard fordert, Lernen müsse »zu einem Thema werden, für das sich unsere Generation voll und ganz einsetzt.« (S. 17)
Er stellt die Frage, warum heutige Schulen noch denen im alten Athen ähnelten, obwohl die Welt und auch der Bildungsgedanke ein ganz anderer geworden seien. Während es damals um eine kleine aristokratische Elite ging, die zu Philosophen ausgebildet wurden, müsse das heutige Ziel »die Entfaltung einer Menschheit von Philosophen, die unsere globalisierte Hightech-Welt erfolgreich steuern kann« sein (S. 18).
Das klingt erst einmal gut. Nur leider auch ziemlich utopisch. Wenn es nicht einmal gelungen ist, eine kleine Elite zu Philosophen zu machen, weshalb Platons Spätwerk (die Nomoi) zunehmend pessimistische Züge annimmt — wie sollten wir, die wir viel törichter sind, und eine viel törichtere Umwelt erschaffen haben, dann etwas viel Schwierigeres vollbringen?
Hierzu bedürfe es einer »Transformation«, auf drei Faktoren beruhend:
ein »neues Denken«, das weder bei alten, starren Begrifflichkeiten verharrt, noch auf die (relativ) neuen Metaphern vom menschlichen Gehirn als Computer hereinfällt und in der KI seine Utopie ansetzt.
»Es besser zu machen«, d.h. auf die menschliche Kreativität zu setzen, und die Zielstrebigkeit, die es braucht, um nicht nur passabel durchzukommen, sondern zu glänzen: »Ein Handwerker will ästhetische Arbeiten abliefern, er kann geschickt mit den geeigneten Werkzeugen umgehen und ist in seinem Element, wenn er seine Techniken beherrscht.« Dies müsse auch für alle Schüler und natürlich die Lehrer gelten.
»Sich engagieren«, d.h. »Die ethischen und humanistischen Dimensionen des Lernens wieder stärker in den Mittelpunkt rücken.« Zentrum aller Bildung müsse ein Wertesystem sein, keine Technologie oder Investmentfrage — diese dürften ihre untergeordnete Rolle spielen, aber wenn sie im Vordergrund ständen, verlören wir unsere eigentliche Zielsetzung aus den Augen.
Klingt nicht übel. Wir widmen uns heute noch dem, was Beard unter neuem Denken versteht, den Rest werden wir uns dann in einem zweiten (und ggf. dritten) Artikel zu Gemüte führen.
1. Künstliche Intelligenz: Hüte dich vor Computerfreaks, auch wenn sie Geschenke bringen!
Beard berichtet von seinen Erfahrungen mit den innovativen Technologien in Richtung KI und Lernroboter, vor allem im Silicon Valley. Einerseits faszinieren ihn die Möglichkeiten der individuellen Lernmöglichkeiten durch digitale Technik. Andererseits haben diese Techniken etwas Unheimliches, Unüberschaubares, und dann wiederum sind die Effekte der neuen Technologien auf die Kompetenzen der Schüler überschaubar. Der Durchbruch ist (noch) nicht gekommen.
Text, Film, Computer? Lehrer!
Ein Vergleich mit dem Aufkommen des Films im 20. Jahrhundert: Ein kluger Kopf wie Thomas Edinson prophezeite 1922, dass der Film »dazu bestimmt« sei, »unser Schulsystem zu revolutionieren.« (S. 33) Diese Revolution ist ausgeblieben und das Arbeiten mit geschriebenem Text steht auf allen Ebenen der Bildung nach wie vor im Vordergrund. Aus Filmmaterial lernen wir schlicht nicht so gut, wie aus Texten. Woran das liegen mag?
Nun stelle sich die Frage, ob Computer die neuen Bücher seien, oder doch nur die neuen Filme. Die Frage bleibt bei Beard offen, er könnte sich vorstellen, dass Computer »vielleicht Bücher hoch zwei« sind — aber bei der Begeisterung für die neuen Möglichkeiten sei zu oft der menschliche Faktor übersehen worden, der bleibe, sich sogar als noch relevanter erweise. Es zeige sich nämlich, dass zu den neuen Technologien Lehrer nötig seien, die diese auch effektiv einzusetzen in der Lage seien, damit die Schüler einen Nutzen von deren Gebrauch hätten:
»Dass der entscheidende Lernfaktor womöglich die Lehrer und nicht ihre Hilfsmittel sind, wurde bei der Jagd nach der technologischen Innovation offenbar häufig übersehen.« (S. 49)
Die Studienlage zeige: Lehrer sind wahrscheinlich sogar »wichtiger … denn je«. Dies passe auch gut zur Erkenntnis des Schachmeisters Garri Kasparow — der 1997 von IBMs Deep Blue im Schach geschlagen worden war —, dass auch 2010 noch nicht die bessere Technik, also der stärkere Computer gewann, sondern dieser von einem geschickten menschlichen Spieler mit schwächerem Computer (Laptop) geschlagen wurde, und dieser wiederum von einem weniger geschickten menschlichen Spieler mit schwächerem Computer, aber »besserer Einsatztaktik«. (S. 55)
Die Frage nach den Lernzielen
Was die Frage aufwirft, was die »bessere Einsatztaktik« ausmacht, wenn wir jetzt nicht mehr an Schach denken, sondern allgemein an den Nutzen des Computers für das Lernen. Und die Antwort hängt wiederum davon ab, was überhaupt als Ziel ausgegeben wird. Wenn wir nicht wissen, welche Jobs in einem Jahrzehnt überhaupt noch existieren werden, woher wissen wir dann, was wir unseren Kindern beibringen müssen?
Beards Antwort sind die Metafähigkeiten, die sie so oder so brauchen werden:
»Kreativität, komplexe Kommunikation und kritisches Denken.«
Und gibt gleich zu: »Unsere Herausforderung heute lautet, dass die große Mehrheit der Kinder diese Fertigkeiten nicht beherrscht.« (S. 57) Was unter anderem auch daran liegt, dass man für diese hoch-komplexen Fähigkeiten Grundfähigkeiten braucht, um die wir nicht herumkommen: Lesen, Schreiben, Rechnen — zudem einen Grundstock an Weltwissen und Weltverständnis, einschließlich der Gesetze der Logik und der Rationalität, wie aber auch der Psychologie und der Emotionen.
»Vielleicht kommen die Roboterlehrer doch nicht«, zieht Beard sein Fazit (S. 46).
2. Geboren, um zu lernen, denn Kinder lernen gern: in Babyschritten
Trotz aller Bemühungen der letzten ca. 30 Jahre, verstehen wir immer noch nur sehr spärlich, wie kleine Kinder »in Gang kommen«, wie sie es schaffen, sich Sprechen und Denken anzueignen. Was wir aber verstehen, ist, dass sie dazu der menschlichen Interaktion bedürfen. Das Kind kann Sprechen und Denken nicht ohne Interaktion, nicht durch bloßes Zusehen lernen.
Aus der Perspektive der Waldorfpädagogik ist das — nebenbei bemerkt — nicht überraschend: Das Kind muss die Dinge nachmachen, denn es lernt durch das Nachahmen. Und es kann nur sinnvoll nachahmen, was es als sinnvoll, also zielgerichtet erlebt, also im Alltag der Erwachsenen.)
Früh übt sich?
Was wir ebenfalls wissen, ist, dass die entscheidendsten Phasen des Lernens schon in der frühen Kindheit liegen. Hier bilden sich die Differenzen zwischen Kindern aus armen und reichen Haushalten aus, die sich in der Folge immer stärker im Lernerfolg respektive Misserfolg auswirken.
Beard beschreibt in diesem Zusammenhang die sogenannte Heckman-Gleichung, die aus ökonomischer Sicht den Wert der Bildung von Geburt bis Tod anzeigt:
»Die steile Kurve des Graphen wäre ideal, um mit dem Rad herunterzubrettern. Von null bis drei Jahre ist der Investitionsrückfluss riesig, von vier bis achtzehn mäßig, von neunzehn an gering.« (S. 86)
Aus dieser Erkenntnis wurde der Fehlschluss gezogen, man müsse Kinder möglichst früh der kognitiven Bildung zuführen, damit sie einen hohen »Investitionsrückfluss« generierten… also frühe Einschulung, Lesen Lernen noch vor der Einschulung, das letzte Kindergartenjahr als eine Art neues erstes Schuljahr, und ganz viel Frühförderung, am besten schon im Mutterbauch.
Früh konsumiert sich…
Intensiviert wurde dieser schnelle Trugschluss natürlich — wie alles in unserer Kultur — durch den Wunsch, aus dieser neuen Marktnische Kapital zu schlagen, d.h. die frühe Kindheit wurde zu einem neuen Markt, auf dem neue Produkte verkauft werden konnten.
Und die besorgt-unbedarften Eltern griffen natürlich zu.
Und die Behörden machten eifrig mit, in der Hoffnung auf bessere schulische Bildung. (Oder warum auch immer. Man rätselt. Es zeigt sich hier eine Parallele zum Lerntechnologie-Wahn.)
Dabei glaube, so die Psychologin und innovative Bildungsforscherin Kathy Hirsh-Pasek, »kein Wissenschaftler«, dass »Lernkarteien funktionierten« oder »dass Kinder noch früher anfangen sollten, lesen und schreiben zu lernen.« (S. 92) Eigentlich wisse jeder, dass »endlose Multiple-Choice-Tests« ebenso sinnlos seien, wie Pausen zu verkürzen, um längere Lernzeiten zu schaffen.
»Und das, obwohl wir wissen, dass körperliche Betätigung Kinder beim Lernen unterstützt, den Gehirnaufbau fördert. Wir sollten nur noch lesen und rechnen, Kunst sollten wir weglassen, und diesen ganzen überflüssigen Kram wie Gemeinschaftskunde.« (S. 91)
Es stellt sich — eigentlich wenig überraschend für Menschen mit einem Fünkchen Weisheit im Leibe — heraus, dass dieser »überflüssige Kram« alles andere als überflüssig ist, weil Menschen, vor allem Kinder, so gar nicht wie Computer oder »Wissensspeicher« funktionieren, sondern wie das, was sie nun einmal auch sind: lebende Organismen, die eingebettet in ihre natürliche Umwelt inklusive Beobachtung, Bewegung, Spiel, Austausch, kurz: Rhythmen, am besten und am freudvollsten lernen.
Kleiner Aside zum Thema Lernzeit
Tatsächlich wurde mir im Referendariat die Zahl genannt, von 45 Minuten einer Schulstunde seien nur 5 Minuten effektive Lernzeit eines durchschnittlichen Schülers. Was bedeuten würde, dass man die Unterrichtszeit auf ein Drittel verkürzen könnte, wenn es gelänge, aus 45 Minuten 15 Minuten reine Lernzeit herauszukristallisieren — bei gleichem Lerneffekt.
Ergebnisse der Unschooling- und Homeschooling-Bewegungen deuten auch in diese Richtung: dass es nämlich ausreicht, um Kindern den normalen Lernstoff einer Schule beizubringen, mit ihnen ein bis zwei Stunden am Tag intensiv und effizient zu lernen, und den Rest der Zeit den eigentlich interessanten Aktivitäten des Lebens zu widmen: dem Spiel, dem Erkunden, dem Erleben, dem Beisammensein.
Nur: Haben Eltern überhaupt die Zeit, sie mit ihren Kindern zu verbringen, wenn diese nur 2 Stunden am Tag zur Schule gingen? Aber dieses Problem ließe sich gemeinschaftlich sicherlich auch lösen.
Kleiner Schwank aus meinem Leben samt Rap-Zitat
Im Übrigen passen diese Ideen auch zu meiner eigenen Schulerfahrung, sowohl als Schüler als auch als Lehrer. Als Schüler hörte ich ca. in der siebten Klasse auf, regelmäßig Hausaufgaben zu machen, und im Unterricht träumte ich eigentlich nur vor mich hin.
»In der Schule nur gepennt, um fit zu sein für’n Rest vom Tag.« (ASD)
Gelernt habe ich trotzdem genug für durchschnittliche, später sogar überdurchschnittliche Noten, was vielleicht daran lag, dass ich aus einem gebildeten Haushalt kam und in der Freizeit nicht gekifft habe, sondern gelesen und Magic: the Gathering gespielt und musiziert. Und als Kind viel mit Lego gebaut. Aber diese Dinge machten intrinsisch Spaß und niemand musste mich dazu anstiften.
Alles hat seine Zeit
Mittlerweile hat die Forschung auf handfest gezeigt, dass die meisten Frühförder-Produkte für Kleinkinder keinen relevanten Effekt aufweisen:
»Außer Wörter braucht ein Baby einen Menschen, um Sprache zu lernen. Von Bildschirmen lernt es nicht.« (S. 92)
Und dass Kinder, die früher lesen lernten (mit fünf statt mit sieben) mit elf Jahren nicht nur nicht besser lesen konnten als die Spätleser, sondern darüber hinaus weniger gerne lasen und zudem ein schlechteres Textverständnis zeigten (S. 93).
Auch dies ist für die Waldorfpädagogik keinerlei Überraschung. Denn wie schon in der Bibel steht: «Alles hat seine Zeit.« (Kohelet 3:1) Es gibt den idealen Zeitpunkt, mit dem Lesen anzufangen, und diesen hat man ganz richtig auf ca. sieben Jahre angesetzt. (Im bildungsmäßig äußerst erfolgreichen Finnland werden die Kinder erst mit sieben Jahren eingeschult. Wer weiß, vielleicht liefe Vieles besser, wenn wir die Kinder ein Jahr später in die Schule schickten?)
(Wobei es natürlich Ausnahmen gibt, d.h. Kinder, die sich früher das Lesen selbst beibringen. Aber auch bei diesen muss darauf geachtet werden, dass sie nicht zu verkopft werden. Die kognitiven Fähigkeiten bringen einem Kind wenig, wenn es nicht auch motorisch, emotional und sozial reifen kann.)
Ihre Erkenntnisse zusammenfassend formuliert Kathy Hirsh-Pasek folgenden kurzen Satz:
»Von frühester Kindheit an lernen wir von Menschen.« (S. 94)
Und das heißt, dass wir diese Menschen, von denen die Kinder lernen, also uns selbst als Erzieher, als Lehrer, als Eltern oder anders Involvierte, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken müssten. In der Sprache der Waldorfpädagogik gesprochen:
«Alle Erziehung ist Selbsterziehung.»
3. Unsere Intelligenz lebt: Mit dem Strom schwimmen
In diesem dritten Kapitel beschreibt Beard zum einen eine Schule, die in Messungen einen der größten Lernerfolge in Großbritannien aufweist, obwohl sie hauptsächlich Kinder aus sozial schwachen Familien aufnimmt: die KSA (King Solomon Academy).
Jedes Kind kann viel lernen
Diese von einem idealistisch-motivierten Lehrer gegründete und von Bildungsinvestoren finanzierte Schule basiert auf der Idee, dass jedes Kind erfolgreich sein kann, dass es also ein Mythos sei, Intelligenz als gesetzt (z.B. genetisch bedingt) anzusehen, sondern es nur darauf ankäme, dass das Kind einen Grund hat, erfolgreich zu sein. Jedes Kind könne lernen, viele Kinder hätten aber keinen Grund, das zu lernen, was Schule ihnen nahebringen will:
»Das Leitbild der Schule … keine Ausreden, hohe Leistung, Vorbereitung auf das Hochschulstudium«
Der Unterricht geht von 7:35 bis 17 Uhr, aber natürlich mit Pausen. Die Idee ist nicht nur, mehr Lernzeit zu schaffen, sondern auch, dass den Schülern wenig Zeit bleibt, sich Unproduktivem hinzugeben. Das Leben wird ganz auf das Lernen zentriert, und zwar mit einer Mischung aus Motivation, Druck, und normalisierender Ritualisierung.
Mythos Intelligenz
Zum anderen widmet sich Beard der Darstellung, wie es zu diesem Mythos der feststehenden Intelligenz gekommen sei. Ausgehend vom Begriff der multiplen Intelligenz nach Howard Gardner — »Die Theorie wurde Anfang der 1980er-Jahre entwickelt, in den 1990ern (sic) widerlegt und in den 2010-ern in Lehrerfortbildungen verankert.«5 (S. 105) — schlägt er einen Bogen ins 19. Jahrhundert: Zu Francis Galton, einem begabten Cousin Charles Darwins, der Intelligenz als vererbt ansah.
Dann in den Beginn des 20 Jahrhunderts: Zu Alfred Binet, der psychologische Forschung zum Lernverlauf von Kindern betrieb und dessen Ergebnisse in den USA dann aber genutzt wurden, um »Menschen mit abweichender Intelligenz auszusortieren«. (S. 106) Im Ersten Weltkrieg wurden die Soldaten der USA psychometrisch beurteilt und entsprechend ihrer Intelligenz in die Offiziersschule oder in die Infanterie gesteckt.
»Das war die Geburtsstunde moderner IQ-Tests und der unausrottbaren Annahme, Intelligenz sei ein für alle Mal festgelegt. Tatsächlich aber trifft der IQ darüber gar keine Aussage.« (S. 106)
Er sei ein relativer Wert, eine »Momentaufnahme«, und die Neurowissenschaften könnten mittlerweile zeigen, dass es sich mitnichten um ein »festes Etikett für das ganze Leben« handle.
Selbst diese Schnecke kann sich entwickeln
Wichtige Arbeiten hierzu habe mit seinen Untersuchungen zum »Dorftrottel im Tierreich«, der Meeresschnecke Aplysia californica Eric Kandel geliefert. «Dorftrottel«, weil sie nur 200.000 Neuronen hat — zum Vergleich, der Mensch verfügt über 100 Milliarden.6 Diese 200.000 Neuronen lassen sich leichter untersuchen als die sehr viel größeren Netzwerke bei höheren Tieren.
Und schon bei der Schnecke lässt sich die sogenannte Neuroplastizität, also die Veränderbarkeit des neuronalen Netzwerks, feststellen, ebenso wie die Neurodiversität, also die Unterschiedlichkeit der Individuen. Bei Menschen sind beide Eigenschaften verstärkt anzutreffen: Das Gehirn bildet sich mit jeder Lernerfahrung bis ins hohe Alter um, insofern Lernerfahrung stattfindet, und jedes Gehirn ist anders.
(Beard empfiehlt zum Thema Neurodiversität das Buch Weit vom Stamm von Andrew Solomon: »ein richtungsweisendes, vielfach preisgekröntes Buch über das Anderssein, das wirklich jeder lesen sollte.« — Solomon beschreibt darin das Phänomen, wenn Kinder ganz anders sind als ihre Eltern, physisch, sozial, oder psychisch. Ein weiteres gutes Buch zu diesem »unglaublich wichtigen Thema« sei The End of Average von Todd Rose, das den Schwerpunkt mehr auf die Aussage legt, dass niemand durchschnittlich ist, denn der Durchschnitt ist eine mathematische Fiktion. Eine wichtige Erkenntnis gerade auch für Lehrer.)
Zurück zur KSA: Das Potential entfalten
Diese beiden Themen werden durch die These der KSA zusammengeführt, dass die Anlage des Kindes gegenüber der Umwelt relativ irrelevant sei:
»Der aktuelle Leistungsstand legt niemanden auf ein Schicksal fest. … Die KSA erkannte das und setzte einfach darauf, dass alle ihre Schüler, ganz gleich mit welchem Hintergrund, über ein riesiges Potenzial verfügen, das sie bisher nur noch nicht aktiviert hatten.« (S. 109)
Was die spannende Frage aufwirft, ob, und wenn ja, wie, dieses Potenzial aktiv aktiviert werden kann!
Sollte Lernen Spaß machen?
Eine beliebte Theorie ist, dass Lernen Spaß machen sollte. In diese Richtung gehen viele Ansätze der »Technik-Utopisten«, bspw. Peter Diamandis, ein Gründer der Singularity University:
»Lernen muss weniger Paukerei sein … dafür mehr wie Angry Birds.« (S. 110)
In diese Richtung denken auch viele Akademiker heutzutage unter dem Stichwort Gamification. Und das nicht nur in Bezug auf das Lernen, sondern auf alles andere auch, vor allem das Arbeiten.
Es müsse doch möglich sein, Kinder so süchtig nach Lernen zu machen, wie sie es nach digitalen Angeboten, Computerspielen, sozialen Netzwerken, etc. sind. Alles, was man tun müsse, wäre, die Aufmerksamkeit zu fesseln, und dazu gibt es selbstredend einen gigantischen Berg Forschung, denn Aufmerksamkeit der User ist die begrenzte Ressource in Zeiten der Internet-basierten Vernetzung von allem.
Lernen durch Manipulation macht denk- und willensschwach
Das Problem dieses ganzen Ansatzes ist, dass es keine klare Grenze zur Manipulation gibt und dass er daher Gefahr läuft, das Gegenteil dessen zu erreichen, was Beard als Ziel ausgegeben hat: Neues Denken. Er läuft Gefahr, den Menschen das Denken richtiggehend abzugewöhnen, und auch das bewusste, willentliche Entscheiden für oder gegen eine Sache.
Dann würde dieser Ansatz den Menschen nicht nur denkschwach machen, sondern auch willensschwach, und er wäre ganz dem Willen und dem Denken der Lenker hinter den Maschinen, also den Tech-Giganten ausgeliefert. Der ideale Konsument, aber nicht gerade der kreative, komplex kommunizierende und kritisch denkende Philosoph!
Ein langer, steiniger, aber schöner Weg
Beard erlebte in seinen eigenen Unterrichtserfahrungen, dass es ihm relativ schnell gelang, die Aufmerksamkeit der Schüler mit kreativeren Arbeitsmethoden zu fesseln. Aber er musste feststellen, dass sie dadurch allein nicht besser wurden, nicht mehr lernten:
»Man konnte in den einfachen, repetitiven Aufgaben völlig aufgehen, aber Fortschritte machte man damit nicht.« (S. 116)
Was uns wieder zurück zur KSA führt, die wie gesagt recht erfolgreich ist, aber nicht auf Gamifizierung setzt, also nicht das Nützliche zum Angenehmen zu machen versucht, sondern das Nützliche als solches zu markieren, sodass man — die Schüler — es will, obwohl es nicht angenehm ist. Und möglicherweise macht gerade dies das Lernen an der KSA so erfolgreich.
Lernen als Beziehungsarbeit
Als ein Baustein. Denn neben dem hohen Pensum an Lernzeit — wir erinnern uns, von 7:35 bis 17 Uhr ging die Schule und für die Abendstunden wurden noch zwei Stunden für Hausaufgaben veranschlagt — war der zweite wichtige Baustein die »Qualität der Beziehungen« (S. 119f.). Und zwar die zwischen Lehrer und Schüler.
An einer normalen Schule hat ein Lehrer typischerweise hunderte von Schülern, weil er viele verschiedene Klassen in ein bis zwei Fächern unterrichtet. Auf keinen kann er sich besonders konzentrieren. (Erneut wusste die Waldorfpädagogik schon früh, dass es besser ist, wenn ein Lehrer nur eine Klasse hat und die Schüler daher intensiv kennenlernt.)
Die KSA hat pro Jahrgang 60 Schüler (in 2 Klassen) und jeder Lehrer betreut ausschließlich einen Jahrgang, d.h. er hat nur 60 Schüler: »Sie kannten die Schüler wirklich.« (S. 120)
Braucht Schule ein Boot Camp?
Zudem legen sie einen großen Schwerpunkt auf die Kernkompetenzen in der Muttersprache und Mathematik. Es gibt nur wenige Wahlpflichtfächer.
Die Schule startet mit einem boot camp, also einer intensiven Einarbeitung und Einschwörung auf das neue Lernumfeld. In zwei Wochen wird es für die Schüler »ganz normal, dass sie mitarbeiten, dass sie sich dauerhaft ordentlich betragen, dass sie alle ihre Aufgaben erledigen, und dass sie stetig und häufig gelobt werden.« Es wird »cool und normal, die Mitschüler zu loben, cool und lustig, ein guter Schüler zu sein.« (S. 120)
Das erinnert zum Beispiel an die Stigmata-Theorie nach Erving Goffman, nur mit umgekehrten Vorzeichen: der Schüler wird nicht abgewertet, sondern aufgewertet. Man könnte auch sagen: Die Realität folgt der Vorstellung. Der Schüler wird, was er seinem Selbstbild nach ist. Ein guter Schüler, oder ein schlechter, ein ordentlicher oder chaotisch, etc.
Beard führt nicht wirklich aus, wie es der Schule gelingt, die Schüler in nur zwei Wochen dermaßen umzupolen, immerhin arbeitet sie ja mit lernschwachen Schülern, die in ihrer bisherigen Schulkarriere niedrige IQs und Erfolgschancen diagnostiziert bekommen hätten.
Es liegt meines Erachtens aber die Vermutung nahe, dass sich ihr Vorgehen nicht komplett verallgemeinern ließe, weil es sicherlich darauf ankommt, dass die Eltern mitziehen. Und Eltern müssen ihre Kinder ja bei der KSA anmelden, d.h. wir haben hier Eltern, die bessere Chancen und Bildung für ihre Kinder wollen. Das ist leider und verrückterweise nicht bei allen Eltern der Fall.
Braucht sie militärische Disziplin?
Was auch klar ist, ist, dass die Schule eher mit »strenger Disziplin« arbeitet, als mit Einladungen. »Keine Entschuldigung, nie, für nichts«, erinnert sich eine ehemalige Schülerin, die jetzt auf dem Wege ist, eine erfolgreiche Anwältin zu werden und ihre Schullaufbahn an der KSA durchweg positiv sieht.
»Man hat recht oder unrecht. Man ist gut oder schlecht. Es gibt eine Linie, und die wird nicht überschritten. Wer sie überschreitet, hat ausgespielt.« (S. 121)
Der Schulleiter habe »mit strenger Wärme die Zügel immer in der Hand.«
Man fühlt sich möglicherweise leicht an militärischen Drill erinnert. Es gehe aber um Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber:
»Wer von der Universität träumte, musste ehrlich sein: Es konnte hier nicht ausschließlich um Noten gehen. Sie mussten Ambitionen aufbauen, Charakter entwickeln und mehr lernen als das, was im Lehrplan stand.« (S. 121)
Zum Beispiel Uni-Schnupper-Kurse in den Ferien, oder ein Musikinstrument erlernen (mit vier Stunden Unterricht pro Woche!). Solche Dinge müssen erst einmal finanzierbar sein. Also auch hier: Ist das überhaupt verallgemeinerbar? Sozusagen eine Kaderschmiede für alle? Ist es wünschenswert?
Lernen muss anstrengen
Beard verfolgt diese Fragen nicht weiter, weil er sich stattdessen einer anderen widmet: Kann es sein, dass Lernen nicht zu viel Spaß machen darf, um effizient zu sein? Kann es sein, dass Lernen etwas mit einem Willensakt zu tun hat, den Angry Birds und Gamifizierung im Allgemeinen gerade unterminiert?
Die Bildungsforscherin Daisy Christodoulou vertritt die Ansicht, dass »ständige bewusste Anstrengung« zum Lernen notwendigerweise dazugehöre. Offensichtlich sei unser Gedächtnis die zentrale Grundlage des Lernens. Etwas zu lernen heiße wesentlich, sich an etwas erinnern zu können, das man durchdacht und verstanden hat. Insofern unser Bildungssystem das Nachdenken über den Lernstoff behindert statt zu fördern, schadet es aktiv dem Lernen. Das Gehirn sei nicht zum Nachdenken gemacht, sondern zum »Vermeiden des Denkens« (S. 127).
Mit Bildung tricksen wir im Grunde also unsere evolutionäre Natur aus, aber oft genug trickst selbige stattdessen uns aus: die Schüler lernen (fast) nichts. Was wiederum daran liegt, dass es dem Lehrer nicht gelungen sei, ihnen die Bedeutung des Themas für ihr eigenes Leben nahezubringen. Oder anders herum, positiv formuliert: Wenn es dem Lehrer gelingt, seine Schüler zum Nachdenken zu bringen, dann haben sie bereits in relevanter Weise gelernt. Wenn nicht, dann wohl nicht.
Mit etwas Selbstreflexion lassen sich diese Thesen gut nachvollziehen. Jedes Kind besitzt ein unglaubliches Vermögen, sich Dinge zu merken, für die es sich interessiert: ob es mit Sport zu tun hat, oder mit Pokémon, die Charaktere einer Serie oder das Lieblingsbuch. Und: je mehr man über ein Thema schon weiß, desto leichter lässt sich weiteres Wissen dazu aneignen, weil es so viele Anknüpfungspunkte gibt, sodass das neue Wissen eine sinnvolle Ergänzung des Bisherigen bedeutet und nicht einen isoliert dastehenden Fakt ohne innere Bedeutung.
Was macht Mathe sexy?
Das ist auch allgemein bekannt. Die goldene Frage lautet dann aber, wie man dafür sorgen kann, dass Kinder Mathematik oder Rechtschreibung, die Beschäftigung mit höherer Literatur und Poesie als sinnvoll und die Anstrengung wert erachten?
Die KSA geht den Weg einer extrinsischen Motivation: Mathematik mag an sich vielleicht irrelevant für Dein Leben sein, aber wenn Du an die Uni willst, dann lernst Du das besser, denn das braucht man für den sehr guten Abschluss nun einmal.
Zudem herrscht die intrinsisch motivierende Vorstellung vor, dass Du ein guter Schüler bist, und ein guter Schüler interessiert sich für das, was der Lehrer präsentiert, egal, was es ist.
(In der Waldorfpädagogik sagt man: Das Schulkind lernt im zweiten Lebensjahrsiebt »aus Liebe zum Lehrer«, voller Vertrauen in das, was der Lehrer bringt. Danach, ab der Pubertät, lernt es nur noch (gerne), womit es sich aktiv verbinden, wofür es Interesse entwickeln kann. Und da Menschen unglaublich neugierige Wesen sind, wäre es nicht schwierig, sich für die Dinge zu interessieren, wenn wir es den Kindern nicht austreiben würden.)
Erlernte Hilflosigkeit — Technik verblödet
Aus einer anderen Richtung kommen weitere Belege für die Idee, dass Lernen erfolgreicher ist, wenn es anstrengend ist: Die Untersuchungen zur Nutzerhilfe. Man könnte auch von erlernter Hilflosigkeit sprechen: Wer daran gewöhnt ist, dass ihm geholfen wird, verlernt, sich selbst zu helfen.
Ein gutes Beispiel sind die Navigationssysteme. Menschen verlernen, sich selbst zu orientieren, wenn sie alle Wege nur noch mit Navi fahren. Sie vertrauen schließlich so sehr auf diese Technik und so wenig auf ihre eigene Wahrnehmung, dass sie verrückte Dinge tun wie in einen Fluss hineinfahren, wenn das Navi ihnen dies sagt (S. 133).
Wenn etwas zu schwierig ist, ist dies frustrierend. Ist es zu leicht, aber auch. Wir benötigen für das optimale Lernen die Reibung an Hindernissen, die nicht zu stark ist, »wünschenswerte Schwierigkeiten« sozusagen. Hier bedürfte es demnach des feinen Gespürs des Lehrers, welche Schwierigkeit ein Schüler oder eine Lerngruppe benötigt, um optimal zu lernen.
Selbstständiges Lernen
Und weiter gedacht, sollte ein Mensch im Laufe seiner schulischen Entwicklung lernen, diese Frage selbstständig und kompetent zu beantworten: Was traue ich mir zu? Woran kann ich wachsen? Was überfordert mich?
(Und Rudolf Steiner führt zur Entwicklung des vishuddha-cakras aus — er nennt es die 16-blättrige Lotusblüte —, man solle nichts versuchen, was außerhalb der eigenen Fähigkeiten, aber auch nichts unterlassen, was innerhalb dieser liegt.)
Wer dies gelernt hat, wird gewissermaßen immun gegen die Verlockungen der Unterhaltungsindustrie, denn der Kick, den man aus dem Konsum von Spielen oder Unterhaltung gewinnt, ist nichts im Vergleich zum Kick einer echten Lernerfahrung. Man versteht, und man empfindet mit seinem ganzen Wesen, dass es überhaupt nicht um Spaß geht, und dass man nur nach Spaß lechzt, wenn man schon zutiefst gelangweilt ist. Wer lernen kann, wird natürlich humorvoll und tiefgründig zugleich werden, aber Spaß braucht er nicht (mehr).
Wer sitzt am Steuer?
Beard fasst seine eigene Lernerfahrungen zusammen:
»Wenn man keinerlei Kontrolle ausübt, lernt man nicht, zumindest nicht im eigentlichen Sinn. Lernen kann nicht wie Angry Birds sein. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, uns selbst verbessern zu wollen, indem wir unsere Technik aufrüsten. Das funktioniert nicht. Man muss selbst die Kontrolle haben. Wenn wir uns nur auf unsere Maschinen verlassen, untergraben wir womöglich unsere eigene menschliche Intelligenz. Das ultimative Ziel des Lernens ist es, in der Lage zu sein, abzuwägen, auszuloten, zu entscheiden. Wir müssen uns selbst fragen: Lernen wir, die Werkzeuge von heute zu benutzen, oder lernen sie uns zu benutzen?« (S. 137, m.H.)
Und er zitiert zustimmend den Biologen Gerald Edelman, demzufolge »jeder Akt der Wahrnehmung … ein Akt der Schöpfung« sei und »jede Gedächtnisleistung … eine Leistung der Fantasie.«
Die Tragik unserer Bildung, könnte man sagen, ist, dass wir so plastisch sind, dass es uns auch möglich ist, wie Maschinen zu funktionieren. Aber wir könnten eigentlich so viel mehr.
Wenn wir nicht darauf hinstreben, unser volles Potential als Individuum, als Gesellschaft und als Menschheit zu entfalten, lassen wir, wie Beard sagt, unsere Kinder im Stich und müssen mit der dumpfen Empfindung, mit dem Pochen unseres Gewissens leben, wie der geniale Schriftsteller David Foster Wallace es ausdrückte, »etwas Unendliches gehabt und verloren zu haben.« (S. 138)
Schon jetzt ist erkennbar, dass für Alex Beard weder die Tech-Utopien des Silicon Valley, noch der Drill einer KSA der Weisheit letzter Schluss sein können. Ich bin gespannt, wohin seine weitere Reise uns führen wird.
Ich freue mich immer wie ein Honigkuchenpferd über alle Kommentare, vor aber interessieren mich diesmal Ideen zur Frage, was Mathe sexy machen könnte? :)
Der nächste Teil:
Aber warum? Man kann die Frage aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. In der Vergangenheit hatte ich Gelegenheit, Mattias Desmets psychologische Antwort auszuleuchten — stark verkürzt: Schuld ist das mechanistische Weltbild. Mit Egon Friedell könnte man sagen: Schuld ist der Hyperrationalismus. Mit Iain McGilchrist: Unsere beiden Hirnhälften arbeiten nicht auf korrekte Art zusammen, sondern diejenige, die eigentlich zu wenig weiß (die Linke), aber nicht weiß, was sie nicht weiß, spielt sich als Meister auf, obwohl sie der Rechten dienen müsste. Mit Ivan Illich: Die Pervertierung des Christentums in der modernen Kirche hat die Vorlage zu gleichfalls pervertierten Institutionen geliefert, die unsere Vorstellungsmöglichkeiten strukturieren. Mit Giorgio Agamben, der an Illich anknüpft und ähnliche Konsequenzen zieht wie Rudolf Steiner: Unsere Welt wird vom Wirtschaftsleben dominiert, wodurch das freie Geistleben sich nicht entfalten kann. Mit Raymond Geuss: Die dominante Erzählung unserer Gesellschaft, der Liberalismus, enthält zu viele Widersprüchlichkeiten, um zu korrekten Vorstellungen beitragen zu können. Gemeinsam ist all diesen Ansätzen eine historische Perspektive: Wo wir heute stehen erklärt sich aus kulturellen Entscheidungen der Vergangenheit, und aus den heutigen Entscheidungen wird sich ergeben, wo wir in Zukunft stehen werden. Die Zukunft ist offen.
Der Blogger und Informatiker Fefe benutzt hierfür den Begriff “fraktal falsch”. Wahrscheinlich hat er ihn selbst auch irgendwoher.
Mit den Co-Autoren Marcell Heinrich und Mitch Senf. Sorry Bros, aber für eure Namen interessiert sich bislang niemand. Wobei ich dem Klappentext entnehme, dass Marcell “Ex-Rapper” Heinrich unter dem Alias Doppel L musiziert, Mitch “Breakdancer” Senf eines der “bedeutendsten Nachwuchsevents der deutschen Breakdance-Szene” gegründet hat und die beiden zusammen die Hero Society ins Leben gerufen haben, “die junge Menschen in Zeiten der Orientierungslosigkeit anregt und sie darin unterstützt, ihre Superkräfte zu entfalten.”
Ich vermute, dass ausschlaggebend letztlich war, dass sowohl Precht als auch Hüther mir nicht unbekannt sind, sodass ich sie einordnen kann und zu wissen vermute, was ungefähr ihre Botschaft sein würde; während Alex Beard mir vollkommen unbekannt war, sodass ich nicht wusste, was mich erwartet.
Wobei etwas unklar bleibt, was genau Beard mit diesem Satz sagen will: ist die Theorie seiner Ansicht nach nun richtig oder falsch? (In einem späteren Kapitel bekennt er sich zu der Ansicht, sie sei falsch und insofern ein Beispiel für den Unsinn im Bildungssystem.
Wichtig beim Gehirn ist nicht nur die Anzahl der Neuronen, sondern auch, sogar vor allem, wie viele Verbindungen zwischen diesen bestehen, Synapsen. Aber mehr Neuronen bedeuten mehr Möglichkeiten für Synapsen, insofern hängen beide Zahlen zusammen, aber nicht streng determiniert. Im menschlichen Gehirn nimmt beispielsweise während der frühkindlichen Entwicklung die Zahl der Neuronen ab, die der Synapsen aber zu.


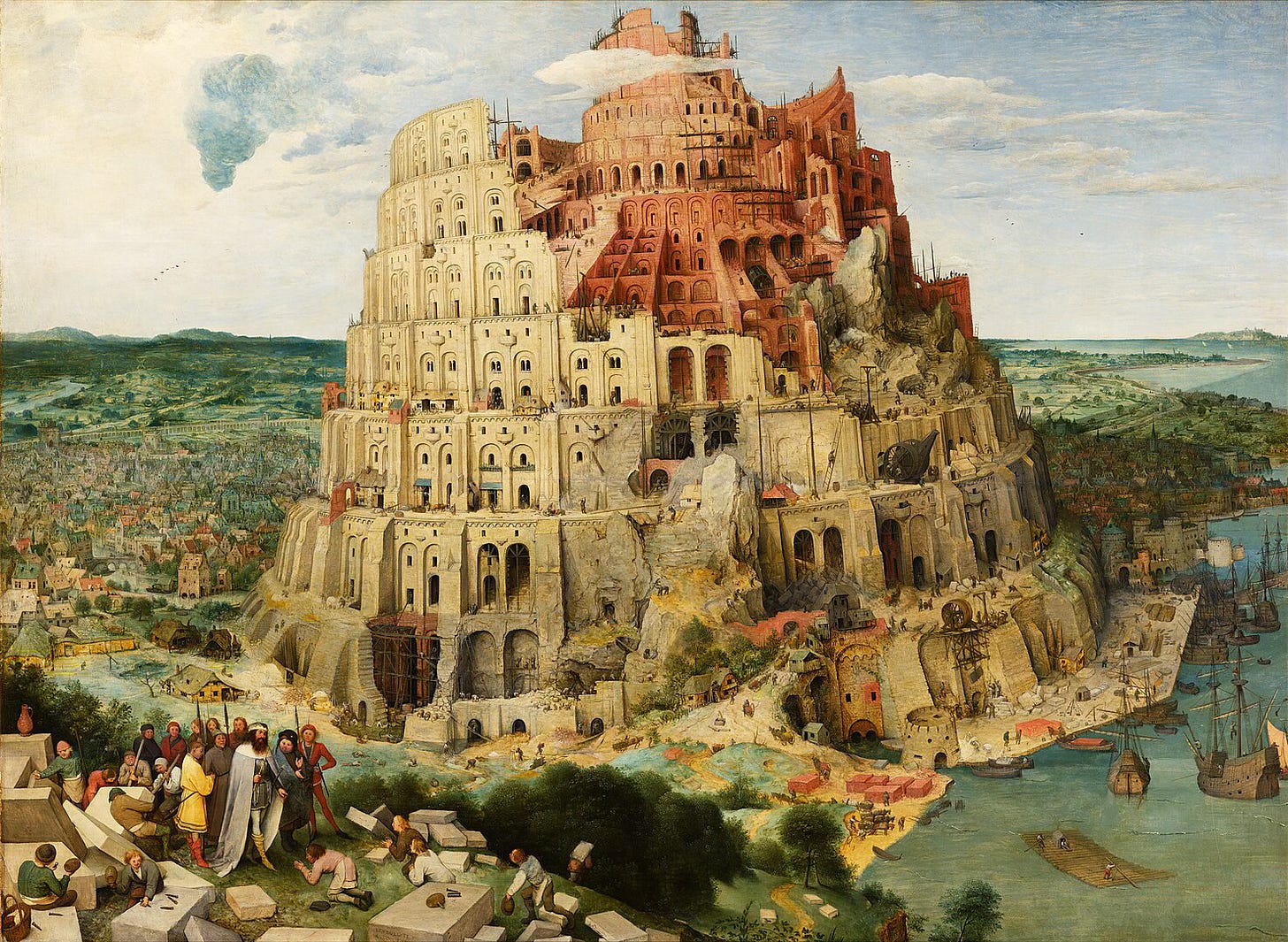
Moist, Dieser Artikel ist viel zu lang. Kommalklaraufdeinleben!
Danke für den Artikel. Sehr informativ und trotz Länge gut lesbar.
Zum Gamification-Aspekt: Ich nutze ihn selbst gerne und meine mein Gehirn so besser zu beschäftigen als durch den reinen Konsum bewegter Bilder. Dennoch würde ich der Aussage zustimmen, dass es die Willensstärke schwächt. Bei Huberman habe ich mal gehört, dass gerade das Unangenehme bzw. die bewusste Überwindung desselbigen den Willen stärkt. Wie immer spielen hier aber wahrscheinlich wieder viel zu viele weitere Faktoren ebenfalls eine Rolle: Gesundheitszustand, Geschlecht, emotionale Verfassung, Beziehungsfragen, persönliche Glaubenssätze… das könnte man wohl ins Unendliche spinnen.
Vielleicht ist es am Ende eine sehr individuelle Frage, wie das Lernen optimal gefördert werden kann. Insofern, denke ich, sind tatsächlich die Lehrer Dreh- und Angelpunkt des Geschehens.
Daher meine Antwort auf die Frage: Wie Mathe sexy wird? Das hängt wohl vom Mathelehrer ab. ;) (was unterrichtest du nochmal?)