Temperamente: Vom flüchtigen Blick zum tieferen Verstehen
Wie das Verständnis der Temperamente uns Kinder näherbringt (Teil 1 von 2)
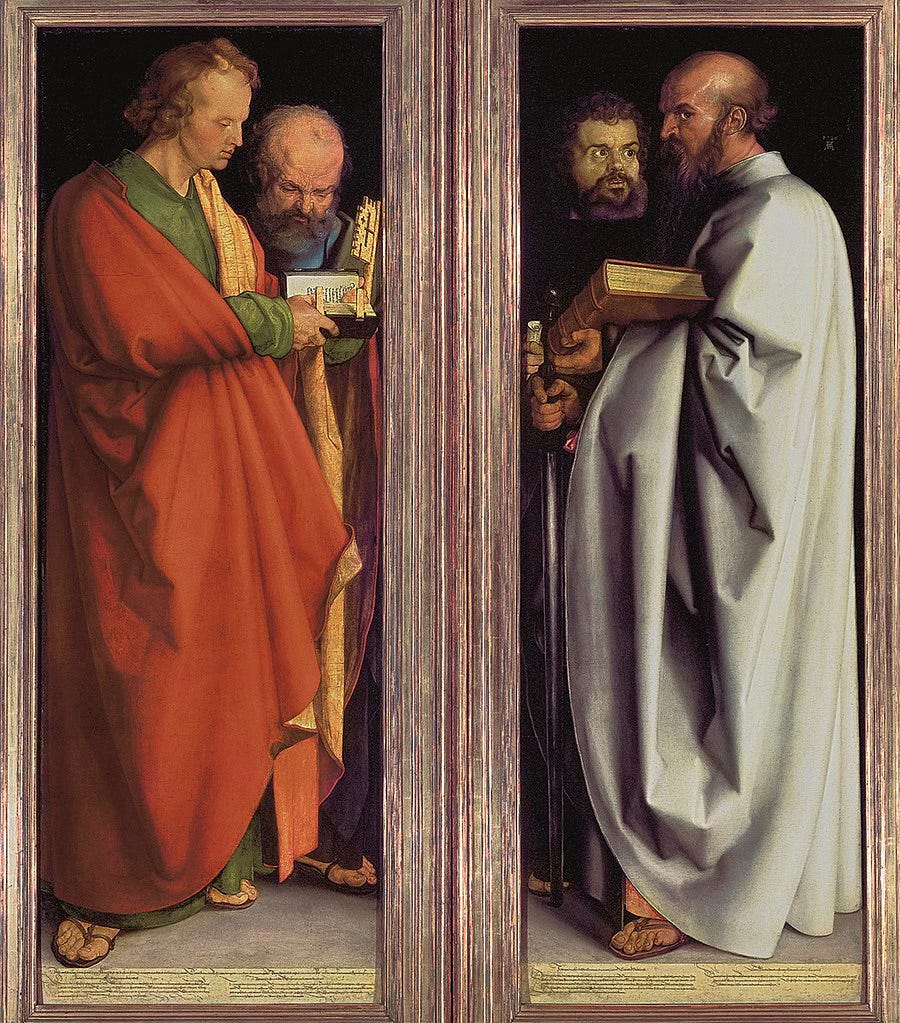
Dieser Artikel entstand als Ausarbeitung eines informellen Vortrags für die Eltern einer Waldorfkindergarten-Gruppe. Ich bin kein Waldorfpädagoge, sondern habe mir das Thema autodidaktisch angeeignet.1 Über konstruktive Kritik bin ich immer dankbar. Viel Spaß beim Lesen :)
Etymologisch Mischungen, stellen die Temperamente eine psychologische Typologie dar, die in der Antike und im Mittelalter entworfen und in der Neuzeit immer wieder aufgegriffen wurde, so auch von Rudolf Steiner, dem Begründer der Waldorfpädagogik.
Steiner bettet diese Typologie in ein metaphysisches Gesamtbild vom Menschen ein, das an dieser Stelle aber nicht weiter ausgeführt werden muss, weil diese Betrachtungsweise als Typologie auch unabhängig vom Welt- und Menschenbild ganz pragmatisch einleuchten kann.
Die Anregungen, die Rudolf Steiner gegeben hat, sollte man seiner eigenen Aussage nach sowieso nur insoweit umsetzen, als man sie gedanklich auch nachvollziehen kann. D.h., wenn einem etwas überhaupt nicht einleuchtet, dann soll man es auch nicht trotzdem aufgrund seiner Autorität umsetzen.
Vorbemerkungen
Eine Typologie hat immer etwas Abstraktes. Die Individuen, die wir in Wahrheit sind, passen nie ganz — oder auch nur großteils — in einen Typen, sondern tendieren lediglich in eine bestimmte Richtung. Das heißt, auch wenn es hier um vier Grundtypen geht, hat jeder Mensch an jedem dieser Typen Anteil. Oft — und gerade beim Schulkind wird das schnell deutlich — überwiegt aber ein bestimmter Typ oder auch zwei.
Jeder Typus hat seine positiven und negativen Eigenschaften — oder was wir darunter verstehen —, d.h. es ist keine wertende Hierarchie damit verbunden, auch wenn wir selbst in der Regel bestimmte Temperamente sympathischer als andere finden werden und das liegt wiederum auch an unserer eigenen Temperaments-Konstitution.
I. Die vier Typen
Nach der antiken medizinischen Lehre des Hippokrates (und in der Folge Galenus’), war jedem dieser Typen ein »Körpersaft« und eines der klassischen vier Elemente zugeordnet:
Sanguiniker — Blut — Luft
Choleriker — Gelbe Galle — Feuer
Melancholiker — Schwarze Galle — Erde
Phlegmatiker — Schleim — Wasser
Diese Zuordnungen können wir — wenn uns die metaphysischen Zusammenhänge nicht interessieren oder sogar unsympathisch sind — auch erst einmal nur als Hilfsmittel, sozusagen Eselsbrücken, nehmen, um uns die Begriffe in ihrem Wortlaut und ihrer Bedeutung merken zu können.
Das Sanguinische
Wenn wir beim Sanguiniker an das luftige Element denken, dann können wir ein erstes Gefühl dafür kriegen, wie dieser Typ ist, nämlich luftig, leicht, fröhlich, kontaktfreudig, bewegt, schnell interessiert, aber auch schnell wieder weg.
Kinder sind tendenziell sanguinischer als Erwachsene. Und ich stelle mir auch gerne den idealen Tagesablauf so vor, dass der Tag sanguinisch startet, fröhlich, nach außen gekehrt, kontaktfreudig, neugierig darauf, was der Tag so bringen mag. So ist auch die Kindheit, wenn man auf das ganze Leben schaut.
Das Cholerische
Der Choleriker ist geprägt von starkem Tatendrang. Er brennt förmlich vor Energie und Schaffenskraft, er will sein Ziel erreichen, gerne schnell und ohne Umwege, er wartet nicht gerne und die anderen sind ihm oft zu langsam. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich vorstellt, tendiert er zu Ärger und Wut. Daher haben wir auch im Alltagsdeutsch das Wort cholerisch und bezeichnen damit jemanden, der schnell »kocht«.
Diese Tatkraft brauchen wir auch im Tagesablauf, um unsere Arbeit, unser Tageswerk zu vollbringen: mit Kraft, mit Fokus, und dem nötigen Durchhaltevermögen, ohne uns zu leicht ablenken oder entmutigen zu lassen. Diese Haltung taugt auch dem jungen Erwachsenen, der ins Berufsleben startet und »loslegen« will, dabei aber vielleicht nicht immer die tiefste Reflexionskraft mitbringt.
Das Melancholische
Der Melancholiker nun ist der nachdenkliche Mensch. Er hat eine gewisse Erdenschwere, tendiert zur Traurigkeit — daher das Alltagswort melancholisch —, hat ein komplexes Innenleben, dessen er sich auch bewusst ist, und denkt gerne und gut nach. Es fällt ihm nur tendenziell schwer, das Erdachte dann auch in die Tat umzusetzen.
Das Melancholische scheint mir eine geeignete Haltung für den Nachmittag, wenn das Werk vollbracht ist und es darum geht, zu reflektieren, was gut gelaufen ist, was nicht, was man sich für den nächsten Tag vornehmen sollte usw. Auch der gereifte Erwachsene, der die ersten stürmischen Berufsjahre hinter sich gebracht hat und in dem jetzt vielleicht die Frage aufkommt: »Wohin hat das alles geführt? Wohin soll es noch führen? Was ist der Sinn dessen, was ich tue?« (Stichwort: Midlife Crisis, wenn diese Fragen nicht zu ihrem Recht kommen), hat etwas berechtigt Melancholisches.
Das Phlegmatische
Der Phlegmatiker letztlich ist der gemütliche Mensch, er hat die Ruhe des Wassers, neigt zur entspannten Bequemlichkeit, liebt die Gewohnheit, kommt nicht schnell in Fahrt, interessiert sich auch nicht so schnell für Dinge, liebt aber gutes Essen und gemütliches Zusammensein.
Dieses Temperament scheint mir gut geeignet, den Tag zu beschließen. Alles, was zu tun war, ist getan, jetzt blickt man der Nachtruhe entgegen, man wird schon einmal passiv, träge, müde und ist zufrieden damit. Diese Haltung eignet auch dem Lebensabend.
Wobei noch einmal zu betonen ist, dass diese Temperamente sich ja durchmischen und z.B. der Lebensabend also natürlich nicht ausschließlich phlegmatisch sein sollte. Aber im positiven Sinne einer gemütlichen, zufriedenen Ruhe darf das Phlegmatische hier gerne »den Ton angeben«, während zu viel Gemütlichkeit und Ruhe im jungen Menschen ihn womöglich daran hindern werden, das Leben ausreichend zu ergreifen und seinen Weg zu gehen.
Wie oft ist es aber so, dass wir den Tag eher phlegmatisch oder melancholisch beginnen, also nicht »in Gang« kommen, uns bei der Arbeit dann nicht konzentrieren können (bspw. weil wir zu sanguinisch sind) und abends dann nicht zur Ruhe kommen, sondern z.B. aktivistisch, cholerisch werden?
Warum sind es vier Temperamente?
Jetzt könnte man fragen: Warum sind es vier Temperamente? Eine mögliche Antwort ist, dass wir zwei Eigenschaftsdyaden haben, die zusammen vier Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Auch hier kann man wieder an die vier Elemente denken, die bei Aristoteles durch die Begriffspaare warm/kalt und feucht/trocken beschrieben wurden:
Luft: feucht und warm
Feuer: trocken und warm
Erde: trocken und kalt
Wasser: feucht und kalt
Bei den äquivalenten Temperamenten könnten wir stattdessen an die Begriffspaare aktiv/rezeptiv und außen/innen denken.
Der Sanguiniker ist nach außen gerichtet, also auf die Welt der Gegenstände und Menschen, dort lebt er, lässt sich aber eher von den Eindrücken treiben, als dass er sie ergreift. Er ist nach außen gerichtet, rezeptiv.
Der Choleriker ist genauso eher nach außen gerichtet, ergreift die Dinge aber, um ihnen seinen Willen aufzudrücken. Er ist nach außen gerichtet, aktiv.
Der Melancholiker ist das Gegenteil vom Sanguiniker. Er ist eher nach innen gerichtet, in Bezug auf sein Innenleben aber aktiv.
Der Phlegmatiker ist das Gegenteil vom Choleriker. Ebenfalls nach innen gerichtet, aber eher rezeptiv.
Das Ziel: Aussteuern der Temperamente
Erneut möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Mensch alle vier Möglichkeiten in sich trägt und alle vier in verschiedenen Situationen auch zu Tage treten werden, dass aber oft ein oder zwei dieser Tendenzen überwiegen. Im Idealfall können wir als gereifte Erwachsene aussteuern bzw. bewusst entscheiden, wie wir uns in einer gegebenen Situation verhalten.
Ein Beispiel habe ich mit dem »idealtypischen Tagesablauf« schon gebracht, wobei dies nur eine Möglichkeit ist, und ein Tag, der auf eine abendliche Feier ausgerichtet ist, möglicherweise am Abend sanguinisch werden will.
Wenn man feststellt, dass man in bestimmten Situationen mit einem bestimmten Temperament reagiert, dass man bspw. in Konfliktsituationen schnell wütend wird, dann kann man bewusst daran arbeiten, statt des cholerischen Temperaments in einer solchen Situation bspw. eher das phlegmatische zum Vorschein kommen zu lassen, also ruhig zu bleiben.
Es ist nicht einfach, sich diesbezüglich umzuerziehen, aber es ist möglich. Und den Beschluss zu fassen, wie man in einer Situation eigentlich am liebsten reagieren will, ist möglicherweise der wichtige erste Schritt.
Bei der Vertiefung unserer Freundschaften wollen wir wahrscheinlich nicht sanguinisch vorgehen, wenn wir aber in Kontakt zu Fremden treten, dann gerade schon. Wenn jemand ohne Absicht etwas kaputt macht, das uns gehört, finden wir vielleicht auch die sanguinische Reaktion, es mit Humor zu nehmen, oder die phlegmatische, gelassen zu bleiben, sympathischer als ein cholerisches Wütendwerden oder melancholisches Verzagen.
Anders herum nutzt uns das Melancholische aber in Situationen, wo es darum geht, gut zu planen und Ordnung und Struktur in eine Sache zu bringen. Und das Cholerische, wenn es dann darum geht, den Plan auch umzusetzen.
Als Eltern ist es für den Umgang mit unseren Kindern hilfreich, wenn wir ihnen ihr jeweils vorherrschendes Temperament widerspiegeln können. Das kann man lernen, je nach Veranlagung ist dies aber nicht leicht. Denn oft lehnen wir bestimmte Haltungen, die uns nicht entsprechen, ab und wollen sie dann bei unseren Kindern auch nicht anerkennen.
II. Das Temperament beim Kind erkennen
Wie gesagt, wird ein gegebenes individuelles Kind nie einem Typus ganz entsprechen und ebenfalls wurde bereits erwähnt, dass Kinder generell etwas sanguinischer sind als Erwachsene, also mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Interesse an den Außeneindrücken, die für sie noch neuer und frischer sind, mitbringen. Zudem kann auch mehr als ein Typus prägend sein, oft wird man aber spätestens ab der Schulzeit einen besonders dominanten Typus erkennen können.
Welchen Nutzen hat dies nun aber überhaupt? Ich denke, darauf kann man viele verschiedene Antworten geben.
Zunächst hilft es uns, besser zu verstehen, wie ein Kind »tickt« und dass sich nicht (schnell) ändern lässt, dass dieses Kind so tickt. Das Temperament lässt sich nicht aberziehen und diesbezügliche Versuche werden es in der Regel eher noch verstärken. Also das phlegmatisch-verträumte Kind wird auf Hektik und Aggressivität eher mit noch stärkerer Ruhe und Zurückgezogenheit reagieren, das cholerische auf übertriebene Langsamkeit von Seiten der Eltern mit Wutausbrüchen und innerer Überhitzung.
Zudem hat Rudolf Steiner alle möglichen Hinweise gegeben, wie man aber doch mit dem Kind daran arbeiten kann, dass es sich von den Einseitigkeiten seines Temperamentes befreien kann, um als Erwachsener weniger eingeschränkt zu sein, sondern freier wählen zu können, ob jetzt die Zeit ist, aktiv oder passiv, nach innen oder nach außen gerichtet zu sein, denn das bedeuten die Temperamente ja aus einer gewissen Perspektive.
Gefahren der einseitigen Steigerung eines Temperaments
Denn diese Einseitigkeiten bieten, wenn sie sich eher noch verstärken als abschwächen, jeweils Gefahren für die Entwicklung des Kindes:
Der Sanguiniker kann oberflächlich werden, unfähig sich zu konzentrieren, bei einer Sache zu bleiben, ruhelos hüpft sein Bewusstsein dann wie ein Schmetterling von Blume zu Blume und er findet keinen Halt.
Der Choleriker neigt zur Wut und das kann schnell dazu führen, dass er Beziehungen zu anderen Menschen zerstört und andere Angst vor ihm haben, wenn er schnell die Kontrolle über sich verliert.
Der Melancholiker, der zur Traurigkeit tendiert, kann trübsinnig und schwermütig werden, ja, alle Lebenslust verlieren und sozusagen im festen Erdelement erstarren.
Der Phlegmatiker schließlich tendiert zum Desinteresse an der Welt, bis hin zum Stumpfsinn, wenn ihn gar nichts mehr anderes interessiert als vielleicht noch das Essen.
Das Einfühlen in das Kind
Um bei einem bestimmten Kind nun das Temperament zu »erkennen«, sollte man nicht eine Checkliste haben, bei der man Eigenschaften abhakt und dann am Ende zusammenrechnet, was dabei herauskommt. Stattdessen muss man mit Bildern der Typen im Kopf das Kind längere Zeit beobachten und abwägen, wo sich was zeigt und was das dann in der Zusammenschau bedeutet.
Alle Kinder werden bspw. ab und an wütend, vor allem in bestimmten Entwicklungsphasen (wie der »Trotzphase«). Aber man kann doch beobachten, dass die Kinder typischerweise auf eine bestimmte Art und Weise wütend werden.
Dabei hilft es, sich einmal vor Augen geführt zu haben, wie ein idealtypisches Temperament in bestimmten Situationen wohl reagieren würde. Helmut Eller hat einige Szenen in seinem Buch Die vier Temperamente, Anregungen für die Pädagogik beschrieben. Eines davon will ich einmal herausgreifen (S. 17f., gekürzt):
Wie das Kind den Lehrer begrüßt
»Das erste Kind kommt! Zügig den Flur entlang! Energischen, strammen Schrittes! Nicht zu überhören! — Schnurstracks auf den Lehrer zu! Der Blick trifft gezielt, die Hand zügig entgegengestreckt! Man grüßt: Guten Morgen, Herr Eller! — knapp, klar, ausdrucksstark! Und weiter geht es, zum Sitz, den Ranzen runter, der Riemen reißt ab, das war zu hastig. Die Mutter hat ihn schon mehrfach geflickt. »Die kann nicht nähen, sie ist schuld!« So, jetzt muss ich warten. Immer noch! Warten mag ich nicht. Morgen komme ich später!« (Cholerisch)
»Ein zweites Kind nähert sich: Ruhig — gemächlichen Schrittes, ein wenig rechts-links schaukend… ohne jegliche Hast … ein wenig verträumt, freundlich dreinblickend. Treuherzig wird die kleine Hand in die des Lehrers gelegt … ohne besonderen Griff, ohne Anstrengung, ganz locker. lächelnd, freundlich, friedvoll wird gegrüßt. Dann weiter … ohne Hast, der Ranzen fällt zu Boden: »Schade, heute konnte ich ihn nicht auffangen… Manchmal bin ich schneller, dann schaffe ich es.« Hinsetzen. »Es ist schön, hier zu sitzen.« (Phlegmatisch)
»Da kommt der Nächste: Leicht beschwingten Schrittes, mit einem Mitschüler an seiner Seite (von nun an sein bester Freund, weil er so nett ist), ihm von seinen wichtigsten Erlebenissen erzähelnd — sich flink auf die Begrüßung einstellen: Das fällt ihm nicht schwer. Freudig die Hand ergreifen, also leicht berühren, mit einem raschen, hellen, strahlenden Blick die Augen des Lehrers streifen, grüßen, und schon streift der Blick weiter, tastet die Gestalt des Lehrers ab, sucht und findet: »Oh, waren Sie beim Friseur?« Oder: »Haben Sie neue Schuhe?« Dann schnell in der Klasse Einladungen zum Geburtstag verteilen. Der ist ja schon in 3 Monaten. Ich wollte die ganze Klasse einladen, aber das geht nicht. Das war schwer für mich, die Richtigen auszuwählen.« (Sanguinisch)
»Bedächtigen Schrittes, die Situation an der Klassentür recht bewusst beobachtend, nähert sich — in feiner, empfindsamer Fragehaltung, die hoffentlich niemand von außen bemerkt — ein weiteres Kind. Es bleibt in einigem Abstand stehen. Es hat bemerkt, dass sein Lehrer noch ganz mit dem (sanguinischen) Hannes beschäftigt ist. … Er nimmt intensiv Anteil an dem, was Hannes da erzählt. »Oh, sein Vater war krank? Wie schrecklich. Wenn mein Vater krank würde? Dann könnte er ja gar nicht zur Arbeit gehen.« Dann die Begrüßung: Wachen Sinnes, in bewusster Haltung, schreitet man auf die Begrüßung zu. Die Hand wird bedächtig, vertrauensvoll, mit behutsamem Griff gereicht. Ernst und fragend erfasst der Blick den des Lehrers — die eigene Stimmung ganz verbergen wollend. Beim Weitergehen kann in ihm die Begegnung noch nachklingen. »Er hat mich wieder so freundlich angeschaut. Das tut gut.« (Melancholisch)
Sich weitere Beispiele ausmalen
In Helmut Ellers Buch können einige weitere Beispiele nachgelesen werden. Man kann sich aber auch eigene Beispiele ausdenken: Wie malt das Kind? (Eller hat dazu Beispiele zusammengestellt.) Wie spielt ein Kind im Sandkasten, wie reagiert ein Kind, wenn etwas kaputt gemacht wird oder wenn etwas nicht so klappt, wie gewünscht? Wie freut sich ein Kind über ein Geschenk? Wann ist ein Kind gelangweilt?
Wann geht ein Kind vollkommen im Erleben auf? (Bspw. können manche Kinder beim Vorlesen vollkommen in die Geschichte eintauchen und bleiben dabei regungslos sitzen, andere hibbeln dabei die ganze Zeit herum oder stehen nach kurzer Zeit auf und rennen einfach weg, aber auch diese Kinder können vielleicht zu anderen Zeiten ruhig zuhören, bspw. wenn sie müde sind oder das Buch das Richtige für sie ist.)
Mit solchen Fragen kann man dann natürlich auch seine Kinder, oder auch andere Kinder, sozusagen mit ganz anderen Augen betrachten. Und wenn man meint, das Temperament des Kindes erkannt zu haben, dann kann man sich wiederum fragen: Wann entspricht mein Kind diesem Temperament aber so gar nicht?, denn auch das wird natürlich immer eintreten.
Insofern kann die Beschäftigung mit den Temperamenten helfen, die ganz einmalige Individualität eines Kinder etwas angenäherter zu erfassen. Ich schreibe »angenäherter«, weil jede Individualität uns für immer ein Geheimnis bleiben wird, wodurch, was das Schöne ist, wir gerade an Menschen, die wir gut kennen, immer Neues entdecken können.
Soweit die Darstellung der Temperamente. In einem zweiten Teil werde ich auf die Arbeit am und mit dem Temperament eingehen, beim Kind wie auch beim Erwachsenen, und auch einen kursorischen Blick auf die Ernährungsempfehlungen werfen:
Über Fragen und Kommentare, sowie über die Weiterverbreitung dieses Artikels freue ich mich sehr :)
Ich beziehe mich in meinen Darstellungen einerseits auf die Vorträge Rudolf Steiners, dann aber auch auf die ausführliche Darstellung Helmut Ellers in Die vier Temperamente: Anregungen für die Pädagogik, Udo Renzenbrinks Ernährung unserer Kinder, sowie die kurze Darstellung zum Thema in der Kindersprechstunde. Die Gesamtdarstellung basiert aber auf meinen eigenen Überlegungen.


sehr interessant und auch gut verständlich, ich denke, man kann auch manchmal den typ wechseln?
Großen Dank, Conrad, für diese Arbeit! Ich bin beglückt und staune, wie du in dieser Kürze alles Wesentliche rund und klar darstellst. Meisterhaft!