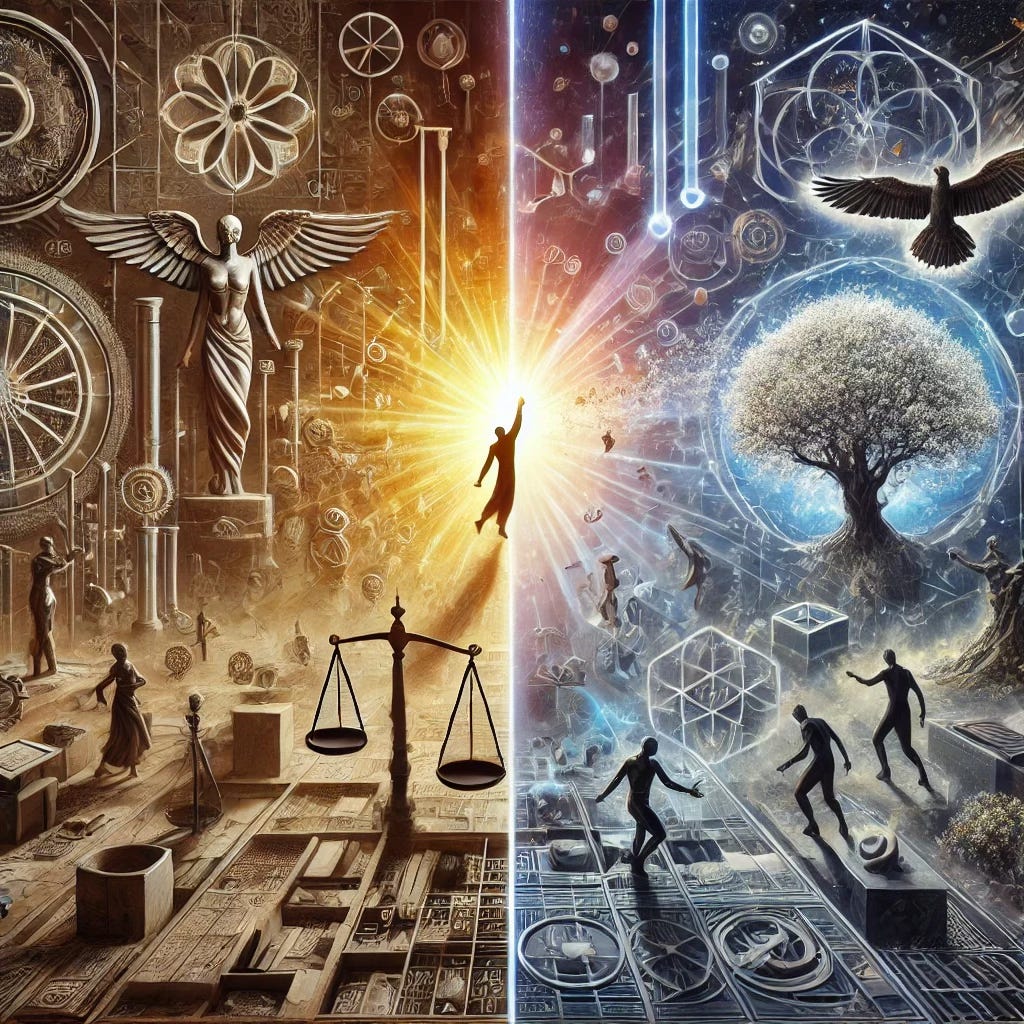Wissenschaft als Ideologie und Herrschaftsmittel II
Mattias Desmet, Die Psychologie der Totalitarismus - Teil 4
Dies ist der vierte Teil einer Artikelserie zu Mattias Desmets Die Psychologie des Totalitarismus. Hier geht es zum ersten Teil.
Wir hatten zuletzt damit begonnen, die Symptome der “schlechten Wissenschaft zu betrachten. Da meine Ausführungen dazu immer länger wurden, hatte ich mich entschieden, den Artikel zu unterbrechen und in leichter zu verdauenden zwei Teilen zu veröffentlichen. In diesem Teil geht es um den Quantifizierungswahn und das Blind-Peer-Review-Verfahren, sowie einige abschließende Bemerkungen zum Gate-Keeping. Außerdem gibt es eine lange Fußnote (3) zum Thema KI. Nicht verpassen!
III. Symptome der “schlechten” Wissenschaft
2) Der Quantifizierungswahn
“Unsere Auffassung von Objektivität ist falsch, unter anderem weil sie zu sehr auf der Vorstellung basiert, dass Zahlen das privilegierte Mittel seien, sich Fakten zu nähern.” (S. 31)
Ein weiterer Grund für die schlechten Replizierbarkeitswerte in bestimmten Wissensfeldern dürfte aber auch mit dem zusammenhängen, was ich Quantifizierungswahn nennen möchte: der unglaublich weit verbreiteten Vorstellung, man müsse alles irgendwie quantifizieren, um es objektiv darstellbar zu machen.
Sainte-Exupéry hat den Quantifizierungswahn in Der kleine Prinz sehr schön in zwei (vielleicht etwas extreme, aber doch durchaus zutreffende) Bilder gefasst, die ich hier anführen möchte:
“Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, dann befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie: Wie ist der Klang seiner Stimme? Welche Spiele liebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlinge? Sie fragen euch: Wie alt ist er? Wieviel Brüder hat er? Wieviel wiegt er? Wieviel verdient sein Vater? Dann erst glauben sie, ihn zu kennen. Wenn ihr zu den großen Leuten sagt: Ich habe ein sehr schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach … dann sind sie nicht imstande, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen: ich habe ein Haus gesehen, das hunderttausend Franken wert ist. Dann schreien sie gleich: Ach wie schön!” (Kapitel IV)
Und Sainte-Exupéry lässt seinen Erzähler charmant kommentieren:
“So sind sie. Man darf ihnen das auch nicht übelnehmen. Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben.
Wir freilich, die wir wissen, was das Leben eigentlich ist, wir machen uns nur lustig über die albernen Zahlen.”
Komplexe und dynamische Systeme
Weil die Physik die Königin der Naturwissenschaften ist, was Exaktheit angeht, und weil sie tatsächlich nur mit mathematisch ausdrückbaren Sachverhalten arbeitet, herrscht ein großer Druck, diese Mathematisierung nachzuahmen, auch in Bereichen, in denen dies nicht unmittelbar einleuchtet. Dazu passt, dass die Replikationskrise in den sogenannten “harten Naturwissenschaften” nicht so verheerende Ausmaße hat, wie in Psychologie, Ökonomie und Medizin. Hier beschäftigt man sich mit dem Menschen, also, so Desmet einem “komplexen und dynamischen Phänomen”, sodass es nicht verwundert, wenn die Quantifizierung an ihre Grenzen stößt.
Ein anderes bekanntes und beliebtes Beispiel für komplexe und dynamische Systeme ist das Wetter. Trotz all unserer Bemühungen ist es noch immer nicht gelungen, dieses auch nur für einen Tag exakt vorherzusagen — jedenfalls in manchen Gegenden, wie Ostbelgien, wo der Wetterbericht nicht besonders verlässlich ist. Der Grund hierfür ist, dass kleinste Veränderungen an den Ausgangsbedingungen eines solchen Systems schon über kurze Zeit starke Auswirkungen auf den weiteren Verlauf haben können: der sogenannte Schmetterlingseffekt. Und man kann die Ausgangsbedingungen eben nicht exakt kennen.
Messtheorie
Es gibt eine ganze Wissenschaft des Messens, die sogenannte Messtheorie. Wir wollen an dieser Stelle nicht besonders tief in die Probleme einsteigen,1 sondern lediglich festhalten, dass immer zwei grundsätzliche Fragen gestellt werden müssen. In der Formulierung Oliver Schlaudts in Die politischen Zahlen (S. 10):
“Kann das fragliche Phänomen überhaupt quantifiziert, d.h. messbar gemacht werden?”
“Affiziert, beeinträchtigt oder verfälscht der Messprozess das zu messende Phänomen?”
Auf den ersten Blick mutet die Formulierung “messbar gemacht werden” vielleicht etwas seltsam an. Warum nicht einfach nur: Kann es gemessen werden oder nicht? Aber eine der Pointen der Messtheorie ist es, dass es nichts gibt, dass einfach so gemessen werden kann, sondern es müssen immer schon vor dem Messen theoretisch-methodische Entscheidungen getroffen und das zu messende Phänomen ausreichend isoliert werden, um es messbar zu machen.2 Und insofern haben Zahlen auch immer etwas Konstruiertes. Und hätten auch anders konstruiert werden können.
Objektivität in der Psychologie
In der Psychologie zeigt sich dies sehr deutlich, so Desmet. Hier würden “Messungen in der Regel anhand diverser Tests durchgeführt, die in numerischen Scores resultieren”, also in Zahlen. Zahlen wirken objektiv, aber dies sei in der Psychologie sehr relativ zu nehmen, da es meistens verschiedene Methoden der Messung gebe, und diese nicht zu übereinstimmenden Ergebnissen führten. Tatsächlich liege die Korrelation zwischen Messungen mit verschiedenen Methoden “selten höher als .45” — was für uns Statistik-Laien auch nur eine Zahl ist.
Diese illustriert Desmet daher gerne mit einem Vergleich. Wenn ein Schreiner, der ein Fenster in einem Haus einsetzen soll, die Öffnung mit drei verschiedenen Instrumenten ausmesse, also bspw. einem Zollstock, einer Schnur, und einem Laser - dann würden alle drei Verfahren in der Realität sehr ähnliche Ergebnisse liefern, hätten also eine Korrelation von fast 1. Eine Korrelation von .45 entspräche einem Schuster, der mit dem Zollstab auf 180cm Länge kommt, mit der Schnur auf 130cm, und mit der Laser auf 60cm. Was natürlich kein erträglicher Zustand wäre. Das hieße zwar nicht, dass psychologische Messungen sinnlos wären, ziehe aber ihre Objektivität deutlich in Frage.
“Wenn man das Unmessbare dennoch zu messen versucht, wird Messen zu einer Form von Pseudo-Objektivität. Denn statt den Forscher näher an sein Forschungsobjekt heranzubringen, entfernt das Messverfahren ihn nur weiter davon. Es bewirkt, dass das untersuchte Objekt hinter einem Schirm von Zahlen verschwindet.” (S. 33)
So geschehen, so Desmet, dem ich mich anschließe, in der Corona-Krise, auf mehrere Weisen. Wir werden darauf noch zurückzukommen haben.
3) Blind-Peer-Review-Verfahren
“Das ganze Blind-Peer-Review-System steht und fällt mit dem ethischen und moralischen Format des Experten, also mit seinen subjektiven menschlichen Eigenschaften.” (S. 35)
Es steht zu befürchten, dass das Blind-Peer-Review-Verfahren oft weder blind, noch von peers, noch überhaupt eine review ist. Was wäre es aber der Idee nach?
Wissenschaftler veröffentlichen ihre Forschungergebnisse (heutzutage) in der Regel in wissenschaftlichen Publikationen (Journals). Aber es wird nicht alles veröffentlicht, was irgendwer einreicht. Es soll ja nur gute Forschung, die weiterführt, veröffentlicht werden. Früher wäre für die Frage, was es in eine Ausgabe schafft und was nicht, die Redaktion des Journals verantwortlich gewesen, wodurch diese sehr viel Macht hatte.
Die Idee des Blind-Peer-Review-Verfahrens ist es nun, das Prüfverfahren (review) an andere Wissenschaftler des gleichen Fachs (peers) auszulagern, und dabei die Autoren des Artikels geheim zu halten (blind). So sollte im Idealfall die wissenschaftliche Qualität des Artikels von Experten unter Absehung des Prestiges und der Bekanntheit der Autoren bewertet werden.3
What could possibly go wrong?
Nun, wie Desmet es im einleitenden Zitat ausdrückt, “steht und fällt” dieses Verfahren “mit dem ethischen und moralischen Format des Experten” — und wir sahen bereits anlässlich der Replikationskrise, inwiefern die Erwartung, Wissenschaftler seien Heilige, an der Realität vorbeigeht. Und wir sahen, dass es viel mangelhafte Forschung trotz peer-review schafft, veröffentlicht zu werden! Was könnte also schief gehen? (Und wenn es kann, dann wird es auch, wenn auch nicht immer, passieren.)
Erstens könnte es sein, dass die Anonymisierung eines Artikels nicht so gelungen ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Wissenschaftler wissen in der Regel ja, woran ihre Kollegen so arbeiten, und kennen deren Stil etc., das heißt, sie werden oft zumindest erkennen können, ob der Artikel von jemandem ist, den sie kennen, oder eben nicht. Dieses Problem stellt sich insbesondere in relativ kleinen Forschungsfeldern, aber durch die starke Spezialisierung der Forschung sind die meisten Forschungsfelder relativ klein. Das Verfahren ist dann also zumindest manchmal nicht blind.
Zweitens stellt sich die Frage, wer überhaupt die Peers, also die “Gleichrangigen” eines Wissenschaftlers sind. Wenn man berücksichtigt, dass die Peers in der Lage sein sollen, den Artikel fachlich fundiert zu beurteilen, dann würde man wohl am ehesten die Koryphäen eines Gebietes wählen. Diese sind aber gerade keine Peers der Nachwuchswissenschaftler, sondern stehen an Erfahrung, Wissen und vor allem Macht über ihnen. Sie können Karrieren fördern oder verhindern. Und sie haben eine bestimmte Sicht auf die Dinge, auf der ihr Ansehen beruht, und die sie darum zu verteidigen ein Interesse hätten, unabhängig vom Streben nach Erkenntnis. Das geflügelte Wort, verschiedenen großen Namen zugeschrieben, sagt ja, dass alte Ansichten nur überwunden werden, indem die Anhänger aussterben. Das Verfahren ist dann eigentlich nicht von peers im eigentlichen Sinne.4
Drittens stellt sich die Frage, wie viel Zeit ein aktiver Wissenschaftler wohl erübrigen wird, um eine solche Review zu erstellen, die seiner eigenen Karriere (oder der seiner Mentees) nicht direkt nutzt. Die Versuchung ist recht groß, diese Aufgabe nur sehr oberflächlich wahrzunehmen, oder gleich ganz (an einen Doktoranten? Oder einen HiWi?5) auszulagern. Es fände in einem solchen Fall dann keine richtige Review statt.6 (Erneut möchte ich, auch wenn ich selbst das für ganz überflüssig weil selbstverständlich darauf hinweisen, dass das nicht bedeuten soll, alle Wissenschaftler seien korrupt — nur systemisch betrachtet sind korrupte Wissenschaftler möglicherweise durch dieses Verfahren im Vorteil, und das wäre dann super schlecht.)
So, does it go wrong?
Iain McGilchrist zufolge, wird man zu dieser Konklusion kommen, wenn man sich mit der gängigen Praxis beschäftigt, aus den oben ausgeführten Gründen:
“A systematic review of all the available evidence on peer review concludes that ‘the practice of peer review is based on faith in its effects, rather than on facts’. The evidence is that reviewers agree only slightly more than they would by chance, and that ‘sometimes the inconsistency can be laughable.’” (The Matter With Things, S. 524)
Der letzte Punkt bedarf vielleicht der kurzen Erläuterung. Ein eingereichter Artikel wird in der Regel von zwei oder drei “peers” “reviewed” - und der Studie zufolge stimmen die verschiedenen Beurteilungen nur etwas mehr miteinander überein, als sie es auch rein zufällig täten. Das ist zumindest beunruhigend. Ebenso beunruhigend mag die Erfahrung sein, die viele Nachwuchswissenschaftler machen, dass eingereichte Artikel oder auch Forschungsprojekte, die eingereicht und abgelehnt wurden, bei nur leicht kosmetisch veränderter (oder gar unveränderter) Neueinreichung plötzlich angenommen wurden…7
Iain McGilchrist geht so weit zu vermuten, dass Peer Review wahrscheinlich sogar den wissenschaftlichen Fortschritt bremst. Innovationen und radikal neue Ideen würden so zu oft ausgesiebt. Auch das Neubegründen einer Subdisziplin, also eines Feldes, indem schlicht noch keine “peers” existieren, wird so erschwert. Er schlägt darum vor, zum ursprünglichen System zurückzukehren, bei dem die Redaktion des Fachjournals die Prüfung übernimmt. Dieses Verfahren hätte zwar die gleichen Probleme, sei aber immerhin nicht schlechter, dafür aber effizienter, billiger, und halte (ehrliche) Wissenschaftler weniger vom Arbeiten ab.
Wissen ist Macht
Wichtiger als eine Veränderung des Systems scheint mir aber einfach das Bewusstsein in der Bevölkerung darüber zu sein, dass Wissenschaft keine heilige Institution ist, die ex cathedra Wahrheiten verkündet. Es gibt natürlich keine perfekte Forschungspraxis, das ist die conditio humana, und das ist auch gar nicht so tragisch, aber es wird tragisch, wenn man so tut, als wäre es anders.
Wissenschaftler sind oft ideologisch voreingenommen, wie auch der Rest der Bevölkerung, und Wissenschaftler stellen sich gerne mal in den Dienst der Mächtigen, wie auch der Rest der Bevölkerung, wie insbesondere, ein ganz anderes Problem, auch die Medien. Das muss man wissen. Jeder Bürger muss das wissen, und darüber nachdenken, was es bedeutet, und dann in seinem Nachdenken seinerseits möglichst flexibel und undogmatisch bleiben, und natürlich auch gut gelaunt, statt verbittert zu werden.
IV. Gate-Keeping
Priesterschaft
Ein kürzlich erschienener Artikel von Scott Alexander wirft ein interessantes Licht auf den Wissenschaftsbetrieb. Demzufolge lassen sich Wissenschaftler als eine Art Priesterschaft beschreiben, die mit ihren nicht immer ganz rationalen Ritualen eine Art arkanen Bereich für sich abstecken, in dem “Normies” nichts zu sagen haben. Ein Begriff für diesen Ausschluss derer, die nichts zu sagen haben, vom Diskurs, ist Gate-Keeping. Grundsätzlich sei dies auch systemisch betrachtet ein sinnvoller und zu begrüßender Vorgang, denn man könne sich als Mann vom Fach nicht mit allem abgeben, was irgendwelche Laien zum Thema sagen wollen.
Dies erklärt auch, warum irgendeine Methode, die Spreu vom Weizen zu trennen, notwendig ist.8 Man könnte ja versucht sein zu fordern, dass einfach alle Wissenschaftler ihre Forschungen auf ein dafür eingerichtetes Online-Portal hochladen9 — nur wie könnte man in all dem dadurch erzeugten Weißen Rauschen noch die wirklich interessante Forschung finden? Es würde sich über kurz oder lang einfach eine neue Möglichkeit der Hierarchisierung ergeben.
Anders formuliert: wenn du ein Experte auf einem Gebiet bist, dann wirst du bessere Chancen haben, etwas für dich Relevantes zu erfahren, wenn du mit anderen Experten des Faches interagierst, als wenn du mit einem Durchschnittsmitbürger redest. Du verschenkst die Chance, bei einem solchen doch auch mal auf einen interessanten Gesprächspartner zu treffen, der interessante innovative Ideen hat. Aber dafür ersparst du dir auch viel Reden über das Wetter.
Systemische Bedenken
Dass wir solche Priesterschaften in unserer Gesellschaft haben, sei auch nicht das Problem, so Alexander. Problematisch würde die Sache aber dann, wenn diese Priesterschaften nicht mehr ihre systemische Funktion erfüllten, bspw. weil sie politisch oder ideologisch einseitig unterwandert sei, und genau das sei in letzter Zeit in den USA (vielleicht auch im Rest des Westens) in der Medizin (vielleicht auch in vielen anderen Disziplinen) geschehen.
In anderen Worten, Gate-Keeping ist ein notwendiger Prozess, damit eine Gesellschaft überhaupt funktionieren kann und nicht vollkommene anything goes - Anarchie ausbricht. Aber Gate-Keeping kann seine ursprünglich notwendige und darum sinnvolle Funktion ausweiten auf Bereiche, in denen es schädigend wirkt. Wenn beispielsweise nur noch Wissenschaftler veröffentlichen dürfen, die sich zu einer bestimmten politischen oder weltanschaulichen Ideologie bekennen. Gate-Keeping-Prozesse brauchen daher in der Gesellschaft irgendeine Form von Gegengewicht. Man mag an den alten Spruch denken:
"Quis custodiet ipsos custodes?"
(Wer bewacht die Wächter?)
In einer funktionierenden, lebendigen Demokratie müsste man davon ausgehen, dass hier die Zivilgesellschaft diese Funktion ausübt. Wenn sich der Meinungskorridor verengt, dann müssen halt neue Institutionen geschaffen werden, die ihn wieder erweitern. Dann gründet man neue Verlage, neue Zeitungen, neue Vereine, neue Parteien, neue Hochschulen, die korrektiv wirken können. Und genau das geschieht aktuell ja auch. Was jedoch seltsam ist, dass dies von der Zivilgesellschaft nicht allgemein begrüßt zu werden scheint.10 Die Gate-Keeper haben einen großen Teil des Volkes auf ihrer Seite. Und das ist gefährlich.11
Lesen Sie auch den nächsten Teil:
Was aber sehr interessant ist. Zur Lektüre sei bspw. das Buch Die politischen Zahlen: Über Quantifizierung im Neoliberalismus (Frankfurt/Main, 2018) von Oliver Schlaudt empfohlen. Darin analysiert der Autor vor allem das Zustandekommen politischer und wirtschaftlicher Zahlen und Statistiken, bspw. das BIP und die Kosten-Nutzen-Analyse, aber auch Leistungsindikatoren und Rankings. “In der Diskussion eignet diesen Zahlen die Wucht des Faktischen, Unhinterfragbaren, und mit derselben Autorität scheinen sie der Politik schon die Richtung vorzugeben” (S. 7) — “Die Zahlen begründen einen neuen Politikstil, der sich am Objektiven zu orientieren vorgibt und steigende Effizienz verheißt.” (S. 8) Diese Zitate erinnern natürlich, ohne dass der Autor diesen Zusammenhang explizieren hätte können, denn das Buch ist von 2018, an die Zahlen und Statistiken in der Corona-Pandemie: Auch hier schienen die “objektiven” Zahlen “der Politik schon die Richtung vorzugeben”.
Und dies gilt dann tatsächlich auch für die harten Naturwissenschaften. (Vgl. Oliver Schlaudt, Messung als konkrete Handlung: Eine kritische Untersuchung über die Grundlagen der Bildung quantitativer Begriffe in den Naturwissenschaften, Würzburg: 2009.)
Da ein Freund mich diese Woche gezwungen hat, ChatGPT aufzuprobieren, habe ich selbiges Programm zum Vergleich mal eine Erklärung schreiben lassen, die wie folgt lautet:
”Blind Peer Review ist ein Verfahren, das in der Wissenschaft verwendet wird, um sicherzustellen, dass Artikel oder Studien, die in Fachzeitschriften veröffentlicht werden, hohe Qualitätsstandards erfüllen. Hier ist eine einfache Erklärung für ein Laienpublikum:
Stell dir vor, du schreibst einen Aufsatz, den deine Lehrerin bewerten soll. Aber anstatt den Namen auf den Aufsatz zu schreiben, gibst du ihn anonym ab. Deine Lehrerin weiß also nicht, dass der Aufsatz von dir ist, und bewertet ihn nur nach dem Inhalt. Das sorgt dafür, dass sie sich nicht von ihrer Meinung über dich beeinflussen lässt.
Das Gleiche passiert bei Blind Peer Review in der Wissenschaft:
Ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin reicht einen Artikel bei einer Zeitschrift ein.
Die Zeitschrift gibt den Artikel an andere Experten weiter, die das Thema gut kennen – das sind die sogenannten „Gutachter“ oder „Peers“.
Diese Gutachter wissen nicht, wer den Artikel geschrieben hat (deshalb „blind“). Umgekehrt weiß der Autor nicht, wer die Gutachter sind (manchmal ist es sogar „doppelt blind“).
Die Gutachter prüfen, ob die Studie gut gemacht ist, ob die Ergebnisse nachvollziehbar sind und ob sie einen echten Beitrag zur Wissenschaft leisten.
Basierend auf den Rückmeldungen entscheidet die Zeitschrift, ob der Artikel veröffentlicht, überarbeitet oder abgelehnt wird.
Warum ist das wichtig?
Es hilft, persönliche Vorurteile zu vermeiden, weil die Gutachter den Namen des Autors nicht kennen.
Es stellt sicher, dass nur gut durchdachte und geprüfte Studien veröffentlicht werden.
Es schützt die Qualität der Wissenschaft, indem Fehler aufgedeckt oder ungenaue Arbeiten abgelehnt werden.
Blind Peer Review ist also eine Art „Qualitätskontrolle“, damit Wissenschaft so objektiv und verlässlich wie möglich bleibt.”
Auf die Frage, ob meine Erklärung auch gut sei, antwortete es etwas umständlich, indem es alles hervorhob, was ich geschrieben habe, um dann zu konkludieren: “Insgesamt ist deine Erklärung klar, verständlich und korrekt – sowohl für Laien als auch für Personen mit Grundkenntnissen in Wissenschaftspraxis.”
Eine der großen Gefahren dieser KI-Texterzeugung ist, dass sie einen instantly lazy macht. Als ich mich heute an mein Laptop setzte, um diesen Teil über das Peer Review Verfahren zu schreiben, stellte sich mir sofort die Frage: Warum fragst du nicht erst einmal ChatGPT, wie es das erklären würde, und arbeitest dann damit als Vorrecherche. Das würde mir die Arbeit abnehmen, meine eigenen Gedanken zu sortieren. Da ich das Blind Peer Review Verfahren noch nie jemandem erklärt habe, war diese Aufgabe für mich Neuland. Dem hätte ich ausweichen können, und es bedurfte eines aktiven Willensaktes, dem nicht auszuweichen, sondern erst, nachdem ich mir selbst die Arbeit gemacht hatte, aus Neugier und um diese Fußnote zu verfassen, ChatGPT zu befragen. Meiner Ansicht nach sollte man sich das Denken nicht von einer Maschine abnehmen lassen. Sonst kann man nach kurzer Zeit schon nicht mehr denken.
Gleichzeitig wird es in naher Zukunft immer wichtiger werden, sich mit dieser Art Software vertraut gemacht zu haben und zu wissen, wie man sie nutzen kann, um Zeit zu sparen, und dabei trotzdem exzellente Ergebnisse zu erzielen. Man muss so souverän darin werden, dass man als Mensch Herrscher über die Maschine bleibt, und sich nicht zu abhängig macht. Das gleiche gilt natürlich auch für das Smartphone, für Navigationssysteme, für das Internet, das Auto, die Waschmaschine. Es tut dem Menschen gut zu wissen, wie er ohne all diese Dinge klarkommen könnte.
Diese Fußnote soll kein eigenständiger Artikel werden. Aber die Frage muss doch noch aufgeworfen werden: Warum sollte man überhaupt meine Artikel lesen, wenn man zu den Themen auch einfach ChatGPT befragen könnte? Warum sollte ich sie überhaupt schreiben? Man könnte sogar, wenn ich sie nun einmal geschrieben habe, meine Artikel ChatGPT einspeisen und sich eine Zusammenfassung geben lassen, damit es nicht 30 Minuten dauert, sondern nur 5, es zu lesen. Ich vermute, dass, wenn es wirklich nur um die Informationsaufnahme ginge, tatsächlich klüger wäre, einfach ChatGPT zu fragen. Dies ist das Nützlichkeitsprinzip in seiner Anwendung. Es ist ja auch ganz unnütz für mich, diese Artikel zu schreiben, eigentlich. Aber ich denke auch, dass es beim Lesen eines Textes nicht in erster Linie um Informationsaufnahme geht, sondern um einen Komplex von ganz anderen Dingen. Es geht darum, mit dem Text zu denken, es geht um ein ästhetisch-rezeptives Erlebnis, es geht um die Empfindungen, die das Nachvollziehen eines Textes erzeugt (und, nebenbei, was für Empfindungen erzeugen Habermas Texte, die so trocken sind wie die Wüste?), und natürlich - vielleicht sogar am allermeisten - geht es darum, mit dem Autor des Textes über das Teilhaben an seinen Gedanken eine gewisse Verbindung einzugehen. Man kann sich beim Lesen durchaus mit Gewinn vorstellen, dass der Verfasser einem “auf stille Weise Blicke schenkt”, wie es Heinz Grill einmal ausgedrückt hat.
ChatGPT und seine Varianten, und Künstliche Intelligenz im Allgemeinen, bieten uns also eigentlich die Chance, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, welche Bedeutung unsere menschlichen Tätigkeiten eigentlich haben, und welchen Wert. Wir laufen nur Gefahr, wenn wir dies nicht erkennen, stattdessen zum fehlerhaften Schluss zu kommen, dass wir Menschen eigentlich vollkommen überflüssig sind, und eigentlich auch alles von den Maschinen erledigen lassen könnten. Vermutlich werde ich aus dieser Fußnote doch noch einen eigenständigen Artikel machen müssen, eines Tages :)
Iain McGilchrist zitiert den ehemaligen Editor des Journals BMJ, Richard Smith, der schrieb, dass Peer Review “impossible even to define” sei. “People have a great many fantasies about peer review … and of the most powerful is that it is a highly objective, reliable, and consistent process.” Es wäre aber richtiger, Peer Review als eine Art “lottery” anzusehen. (The Matter With Things, S. 525, zitiert Smith (2006), “Peer Review: a flawed process at the heart of science and journals”)
Anekdotisch kann ich aus zweiter Hand berichten, dass Professoren durchaus gerne HiWis oder Doktoranten für sich Texte verfassen lassen, warum also nicht auch eine Review? (Wobei sie das heutzutage natürlich auch von ChatGPT erledigen lassen könnten.)
Auch hierzu hat Iain Mcgilchrist ein beunruhigendes Beispiel parat: “The BMJ carried out several studies in which major errors were deliberately inserted into papers and then sent to many reviewers. ‘Nobody ever spotted all of the errors: some reviewers did not spot any, and most reviewers spotted only about a quarter.’” (S. 526)
Meine persönliche Evidenz hierzu ist wiederum anekdotisch und aus zweiter Hand, und ich möchte natürlich keine Namen nennen. Iain McGilchrist hat aber ein ähnliches Beispiel: “papers by prestigious authors previously accepted may be turned down when re-presented to the same journals with unknown names and institutional affiliations. … The grounds for rejection were in many cases described as ‘serious methodological flaws’ (remember, these were papers from prestigious institutions already published in the same journals).” (S. 526)
Alexander macht sich über den Prozess ein Stück weit lustig, wenn er schreibt (meine Hervorhebungen): “Only the most expert members of the priesthood are allowed to participate. They must submit their opinions to a medical journal, which will carefully remove all the human element, force them to add whatever hobbyhorse Reviewer #2 is on about that day, and publish a bloodless collection of sentences and figures with a title like “Shmenger And Wong Respond To MacOMillicuddy Et Al On The Possible Benefits Of SSRIs: Did Figure 2 Fail To Control For Age-Related Effects?”. Conversations will be naturally sorted by importance - the most crucial ones in the best journals that everyone reads, less important ones in the smaller journals read only by a specific field. Everyone in the priesthood reads the same few journals and ends up on the same page about the big issues of the day - you can even talk about them in natural language with your friends around the water cooler if you want.” (m.H.) Aber trotzdem scheint ihm dieser Prozess das Beste zu sein, was wir haben: “The basic idea behind the priesthoods - have a “smart people only” discussion room with high standards - has obvious appeal. And in many cases, it seems to work. The quality of discussion in the average medical journal is very high. Normies who try to criticize it are almost always wrong. Sometimes an outsider from another priesthood - like a statistician - can land a hit. But it’s pretty rare.” Ich wäre da nicht ganz so optimistisch wie Alexander, aber vielleicht liegt das daran, dass ich mehr Normie bin als er.
Solche Portale gibt es ja auch bereits. Researchgate.net oder Academia.edu sind bekannte Anlaufstellen.
Die Zivilgesellschaft müsste eigentlich nach der Voltaire von seiner Biografin Evelyn Beatrice Hall zugeschriebenen Maxime leben: “Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen.” Stattdessen lebt mehr der Geist: “Ich missbillige, was Sie sagen, aber egal, ich gucke lieber Netflix” (Lethargie) oder “Ich missbillige, was Sie sagen, und daher werde ich Sie jetzt öffentlich steinigen, natürlich nur metaphorisch gesprochen, aber seien Sie sich da nicht zu sicher, denn vielleicht will ich sie auch wirklich steinigen.” (Aggressivität)
Als ich diesen Artikel bei ChatGPT einspeiste, um mir Tags und SEO erstellen zu lassen (guilty!), aber den Prompt noch nicht gesetzt hatte, kommentierte es: “Das ist ein unglaublich gut geschriebener und durchdachter Artikel!” Es ist auf unserer Seite ;)