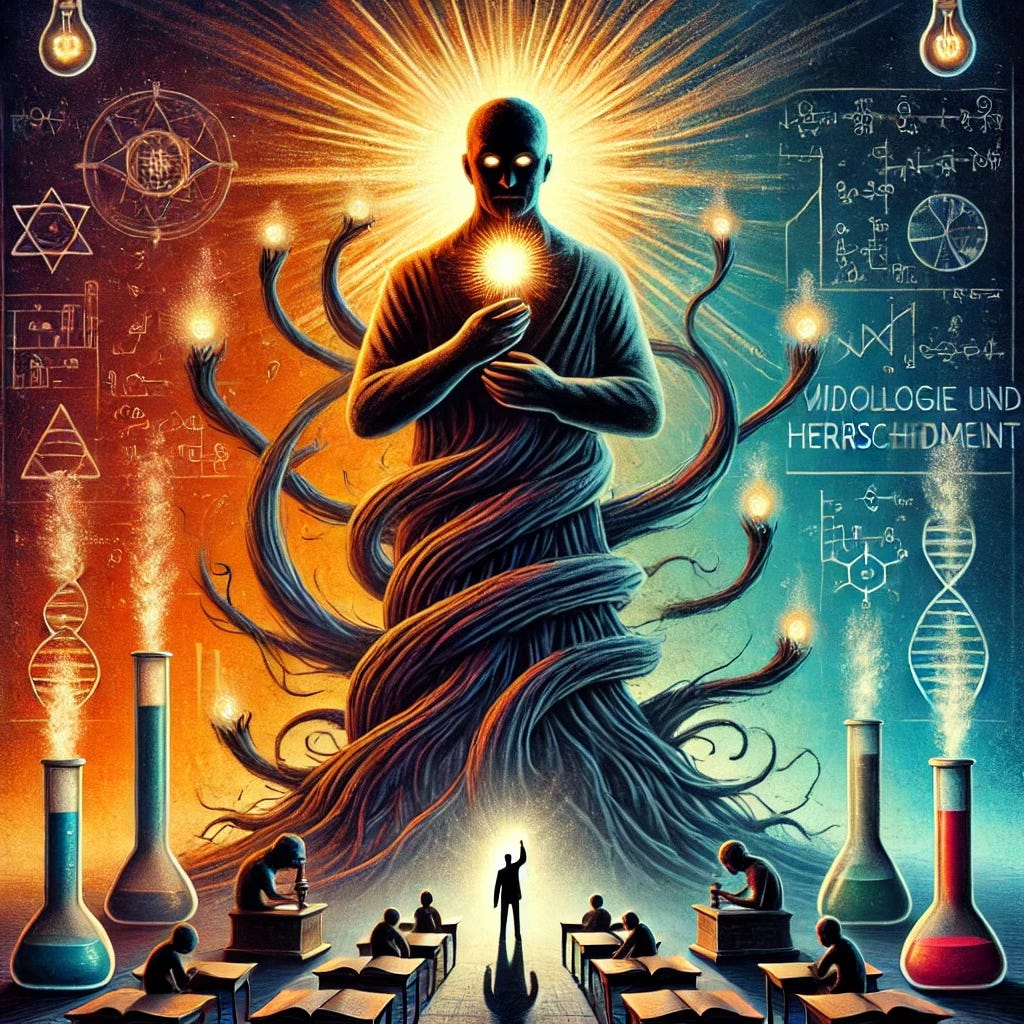Wissenschaft als Ideologie und Herrschaftsmittel I
Mattias Desmet, Die Psychologie der Totalitarismus - Teil 3
Dies ist der dritte Teil einer Artikelserie zu Mattias Desmets Die Psychologie des Totalitarismus. Hier geht es zum ersten Teil. Und hier zum zweiten Teil.
“Will man geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet”, lässt Antoine de Sainte-Exupéry seinen Erzähler von Der kleine Prinz reflektieren. Und ist es nicht tatsächlich ein ziemlich schmaler Grad zwischen dem berechtigten Darlegen der Gedanken anderer zur Entwicklung der eigenen auf der einen Seite, und dem Aufschneiden auf der anderen? Aber geistreich wollen wir ja sein — und nicht bloß scheinen1 —
Dennoch frage ich mich, ob es überhaupt notwendig wäre, auf die Frühgeschichte der modernen Naturwissenschaften einzugehen, oder ob die Sache damit nicht bloß unnötig — und schlimmstenfalls sogar aufschneiderisch — verkompliziert wird. Mich interessieren diese Details; und mich interessiert die Tiefenwirkung Francis Bacons und noch mehr die Frage nach dem Sinn der Philosophie, wie auch dem Sinn unserer Existenz im Allgemeinen, und die These, dass Nützlichkeitserwägungen daran ganz vorbei gehen und ins Leere laufen.
I. Die “schlechte” Wissenschaft - der dominante Weg
Aber Desmet erzählt die Geschichte vielleicht viel klarer, wenn vielleicht auch etwas dilettantisch, wenn er einfach davon spricht, dass es zwei Zweige am Baum der Wissenschaften gebe:
den echt wissenschaftlichen, für den auch die Namen von Kopernikus bis Newton und darüber hinaus stehen; und
den, der Wissenschaft zur szientistischen Ideologie macht, und für den die Tradition steht, die mit Bacon und Descartes ansetzt, auch wenn dies vielleicht nicht den bewussten Intentionen dieser hochkarätigen Denker entsprach.
Durch diesen letzteren Zweig wird Wissenschaft zum herrschenden Diskurs, verliert die Offenheit und ersetzt sie durch unanzweifelbare Dogmen, rebelliert nicht mehr gegen die Mehrheitsmeinungen, sondern setzt sie.
“Damit eignete sie sich nun auch für Zwecke, die den ursprünglichen Zwecken entgegenstanden. Man konnte mit ihr die Masse manipulieren, Karriere machen (je mehr wissenschaftliche Publikationen, desto größer die Chance, Professor zu werden), Produkte an den Mann bringen (›Untersuchungen haben erwiesen, dass unser Waschmittel am weißesten wäscht‹), hinters Licht führen (›Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe‹, Winston Churchill), andere herabwürdigen und stigmatisieren (›Wer an alternative Heilkunde glaubt, ist ein irrationaler Tor‹), ja sogar Segregation und Exklusion verantworten (seit der Coronakrise kein Zugang mehr zum öffentlichen Raum, wenn man das Zeichen der wissenschaftlichen Ideologie nicht trägt). Kurzum: Der wissenschaftliche Diskurs wurde, genau wie jeder andere dominante Diskurs, zum privilegierten Instrument von Opportunismus, Lügen, Betrug, Manipulation und Macht.” (S. 28f.)
(Un)praktischerweise können genau die positiven Seiten der wissenschaftlichen Forschung dazu genutzt werden, die hier aufgelisteten unerwünschten Seiten zu verdecken. Unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit kann man den Leuten alles erzählen. Auch wenn es gar nicht dem entspricht, was bei einer genauen Betrachtung echter wissenschaftlicher Erkenntnisse herauskäme. Denn die Leute, einschließlich vieler Wissenschaftler, haben ja gar nicht die Zeit, und auch nicht die Fähigkeiten, es zu überprüfen.
Vertrauen in die Wissenschaft
Das bedeutet aber, dass unsere verwissenschaftlichte Gesellschaft in ihrem Funktionieren auf dem Vertrauen gegenüber dem Wissenschaftsbetrieb basiert. Wenn dieses Vertrauen durch “Opportunismus, Lügen, Betrug, Manipulation und Macht”, also all dem, was das Handwerk der Politik ist und schon immer war,2 weil eben ein Nützlichkeitsprinzip und kein Wahrhaftigkeitsprinzip herrscht, untergraben wird — droht dieser Gesellschaft ein Rückfall in die Barbarei. Interessanterweise aber auch, wenn das Vertrauen fälschlicherweise bestehen bleibt. Eine Gesellschaft, die alles glaubt, was wissenschaftliche Experten ihr erzählen, kann zu allem bewegt werden, wie die diesbezüglichen Experimente im dritten Reich und Stalins UdSSR zeigten.
In anderen Worten, eine Bevölkerung, denen manipulative Wissenschaft geboten wird, kann sich im Grunde fast nicht mehr “richtig” verhalten. Entweder sie wittert den Betrug und wird unwissenschaftlich, oder sie fällt drauf rein, und wird es ebenfalls. (In der Realität wird ein Teil der Gesellschaft den einen Weg beschreiten, und ein anderer Teil den anderen.) Nur eine Bevölkerung, die so gebildet und mündig wäre, die Spreu vom Weizen trennen zu können, hätte noch eine Chance. Eine solche Bevölkerung wäre wünschenswert, ist aber bisher niemals realisiert gewesen.
II. Die “gute” Wissenschaft - der nicht beschrittene Weg
Wahrsprechen
Die “gute” Wissenschaft hätte laut Desmet zu einem anderen Stand geführt. Diese von ihm als “frische Wissenschaft” bezeichnete Ausrichtung sei an der Wahrhaftigkeit, am ehrlichen Streben nach Erkenntnis um ihres selbst willen ausgerichtet. Desmet übernimmt von Foucault hier den Begriff des “Wahrsprechens”:
“Wahrsprechen ist eine Form des Sprechens, das einen (gesellschaftlichen) Konsens durchbricht. Wer die Wahrheit sagt, bricht die erstarrte Erzählung auf, in der die Gruppe Zuflucht, Behaglichkeit und Sicherheit sucht. Das macht das Sprechen der Wahrheit auch gefährlich. Es jagt der Gruppe Angst ein, sorgt für Irritation und Aggression.” (S. 22)
Dies sei die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft: den Konsens immer wieder neu zu durchbrechen und durch eine richtigere Vorstellung zu ersetzen, um diese dann ebenfalls wieder zu überwinden, und immer so weiter. Der Wissenschaftler darf eben nicht bequem sein, er muss “Unsicherheit zu einer Tugend” erklären, er muss für die “Diversität von Ideen und Gedanken, Annahmen und Hypothesen” eintreten.
Kulminationspunkt
Und oft waren und sind Wissenschaftler auch so, sodass ihre Arbeit der letzten Jahrhunderte immer wieder Einschränkungen im Denken überwand, bis sie schließlich, so Desmet, eine Art Kulminationspunkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfuhr, zu “sublimsten Einsichten, “Überraschenden Einsichten” kam. Die Quantenmechanik habe gezeigt, dass die beobachteten Objekte nicht unabhängig vom Beobachter seien, und dass man niemals vollständige Gewissheit in der Physik oder Mathematik erlangen könne. Und die Chaos- und Komplexitätstheorie zeige, dass der Materie eine Tendenz zur Selbstorganisation innewohne.3
Durch ihre Ergebnisse und die Theoriebildung darüber seien diese Physiker dazu angeregt worden, die Poesie in der Physik wiederzufinden, ja sogar “die religiöse Erfahrung, die jeglicher Form von religiöser Institutionalisierung vorausgeht” —
“Wissenschaft hatte sich von allen Dogmen des religiösen Diskurses befreit, entdeckte jedoch am Ende der Reise die mystischen und religiösen Texte wieder und gab ihnen ihren frischen, ursprünglichen Status zurück: symbolische, metaphorische Texte für dasjenige, was sich dem menschlichen Verstand ewig entzieht.” (S. 26)
Der Mensch als ethisches Wesen
Es sei falsch und unehrlich, die Welt als Maschine und den Menschen als Automaten zu konzeptualisieren und als vollständig enträtselt hinzustellen. Ehrliche Wissenschaft zeige schnell die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnisfähigkeit auf, und diese lasse sich nicht auf den Menschen als ethisches Wesen ausdehnen. Die beachtlichen Erfolge in der mathematischen Beschreibung rein physikalischer Systeme (und, das erwähnt Desmet jedoch nicht, die gelungene Reduktion der anorganischen Chemie auf die Physik) habe eine Art Größenwahn ausgelöst: Wenn sich Planeten und fallende Steine auf die gleiche Art beschreiben ließen, dann müsse dies auch für alles andere gelten unter der Sonne und darüber hinaus.
Dieser erkenntnistheoretische Größenwahn (der Mensch als Gott) kippt in der Folge dann interessanterweise ins Gegenteil, wenn dem Menschen als reiner Teil der Natur jede höhere Befähigung zu Erkenntnis und ethischer Selbstbestimmung abgesprochen wird (der Mensch als Tier). Dies ist tragisch, weil eine unlogische und überflüssige Schlussfolgerung.
Nicht die menschliche Ratio ist das Entscheidende, sondern der Mensch als Wesen, das ethische und moralische Entscheidungen trifft, der Mensch in seinem Verhältnis zu seinem Mitmenschen, der Mensch in seinem Verhältnis zum Unsagbaren, das im Kern der Dinge zu ihm spricht.” (S. 26)
Wäre die Menschheit vor allem diesem Weg der Wissenschaften gefolgt, hätte sie sich schon längst vom naiven Materialismus (oder Physikalismus) lösen und nach einer tieferen Erkenntnis der Welt jenseits des Materiellen (Physikalischen) streben können. Ansätze zu dieser Art von Forschung sind vorhanden, aber sie sind bislang eher Keime, die darauf warten, aufgegriffen zu werden. Stattdessen verwickelt sich die Menschheit meiner Beobachtung nach aber aktuell immer tiefer im Nutzenprinzip: Sicherheit, Bequemlichkeit und Bewusstlosigkeit sind seine Götzen.
III. Symptome der “schlechten” Wissenschaft
1) Die Replikationskrise
“Je mehr der wissenschaftliche Diskurs zur Ideologie wurde, desto mehr verlor er die Merkmale des Wahrsprechens. Nichts illustriert dies besser als die Krise, die 2005 in der akademischen Welt ausbrach — die sogenannte Replikationskrise.” (S. 29)
Über diese Replikationskrise sollte eigentlich jeder Bürger bescheid wissen. Sie sollte im Schulunterricht durchgenommen und in Zeitungen diskutiert werden. Stattdessen wird sie nach Möglichkeit nicht thematisiert, und wenn doch, wird so getan, als läge sie bereits in der Vergangenheit und das Problem sei gar nicht so gewichtig gewesen, vor allem aber schon längst behoben. (Eine angenehme Ausnahme bildet der englischsprachige materialreiche Wikipedia-Artikel.)
Die Replikationskrise brach 2005 aus, als sich herausstellte, dass in vielen Zweigen der Wissenschaft große Anteile der wissenschaftlichen Studien in ihren Ergebnissen nicht replizierbar waren, d.h. wenn “verschiedene Forscher das gleiche Experiment durchführten, kamen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen.” (S. 30) Neben echten Betrugsskandalen4 wurden als Ursachen für diesen Befund “mildere Formen fragwürdiger Forschungspraktiken” vermutet, “die wahrhaft epidemische Ausmaße annahmen.”
Einer Untersuchung von 2009 zufolge gaben 72% der anonym befragten Wissenschaftler die Bereitschaft zu, “ihre Forschungsergebnisse in irgendeiner Weise zu verdrehen.” Zusätzlich ließ sich zeigen, dass auch unbeabsichtigt haufenweise Rechen- und andere Fehler gemacht wurden, sprich: dass Wissenschaft in großen Teilen nicht besonders sauber arbeitete, teils aus Unvermögen, teils aus Berechnung. 2021 gaben noch immer 50% der Akademiker zu, “dass sie ihre Befunde mitunter tendenziös darstellen.” Wahrscheinlich liegt die wahre Zahl höher, denn selbst anonym werden manche Menschen ihre schlechten Eigenschaften oder ihre Unredlichkeit nicht eingestehen können oder wollen.
Wie groß ist das Problem?
Das kommt auf die betrachtete Wissenschaft an. Desmet zufolge sei die Replikation der Studienergebnisse in den Wirtschaftswissenschaften in 50%, in der Krebsforschung in 60%, und in der Biomedizin in beachtlichen 85% der Fälle nicht gelungen. Letzterer Befund veranlasste den weltberühmten Statistiker John Ioannidis schon 2005 zu dem ebenfalls berühmten Artikel mit dem illustren Titel:
Auch Iain McGilchrist hat sich im Rahmen seiner fulminanten Studie zur Hirnhemisphären-Forschung und ihrer philosophischen Bedeutung The Matter With Things mit der Replikationskrise auseinandergesetzt und bietet weitere Details. Demnach waren auch in der Psychologie nur um die 50% der untersuchten Studien reproduzierbar. Aber das Problem existiert auch in anderen Fächern:
“A survey of 1,576 researchers across scientific disciplines published in Nature revealed that more than 70% of researchers had tried and failed to reproduce another scientist’s experiments, and more than half had failed to reproduce their own experiment. In fact, more than half thought there was a significant crisis in research reproducibility … less than 20% said that they had ever been contacted by another researcher unable to reproduce their work.” (S. 513f.)
Moloch Medizin
Insgesamt scheinen sich die Forscher aber einig zu sein, dass der Zustand im Bereich der Medizin am schlimmsten sei. Und der oben bereits erwähnte Artikel von Ioannidis liefert ein paar mögliche Erklärungen:
aufgrund der oft hohen Kosten haben die Studien häufig nur eine kleine Anzahl an Teilnehmern, was leichter zu falsch signifikanten Ergebnissen führt
hohe Konkurrenz verschiedener Teams hat den Effekt, dass alles sehr schnell gehen muss und weniger genau gearbeitet wird
es geht um viel Geld!
Gerade dieser letzte Punkt sollte eigentlich niemanden überraschen. Wissenschaftler sind Menschen, und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass sie gehobenere ethische Ansprüche an sich selbst anlegten als es der Rest der Bevölkerung tut. Ganz im Gegenteil sind die Anreize, nicht ganz fair zu spielen, gewaltig.5
Denn als junger Wissenschaftler muss man veröffentlichen, und zwar relevante Ergebnisse, um eine akademische Karriere verfolgen zu können. Bevor man sich also um die Wissenschaft kümmern kann, muss man sich erst einmal um seinen Platz im Wissenschaftsapparat kümmern. Und ob man dann, wenn man “es geschafft” hat, noch in der Lage sein wird, seine Werte irgendwo wiederzufinden?6
Ursprünglich wollte ich jetzt noch den Quantifizierungswahn und das Blind-Peer-Review-Verfahren besprechen. Da der Artikel aber bereits recht lang ist, werden wir dies nächste Woche nachliefern:
“Wenn es Gott nicht gibt”, sinniert Roberto Bolaño in einem Interview mit Rodrigo Pinto, “dann ist Anerkennung — wie beispielsweise auch Geld — ein Krümelchen, für das sich niemand, der noch bei Trost ist, wirklich interessieren kann oder höchstens so wie für einen geschmacklosen Witz. Wenn es Gott aber gibt, ist die Anerkennung unerheblich, schließlich kennt Gott ja alle Namen und Gesichter.”
So schreibt bspw. Hannah Arendt in Wahrheit und Lüge in der Politik: “Wahrhaftigkeit zählte niemals zu den politischen Tugenden, und die Lüge galt immer als ein erlaubtes Mittel in der Politik.” Dem sei zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurden in der Reflexion über Politik. Allerdings darf die Politik hierin nicht übertreiben. Der Verlust an Vertrauen in die Politik (“sind doch alle korrupt/machtgeil/auf den eigenen Vorteil bedacht…”) zeigt sich auch in der zunehmenden Forderung nach Transparenz. Diese Forderung nach Transparenz zeigt eigentlich bereits einen sehr kritischen Zustand der Politik an, weil sie logisch ja nur aus einem Mangel an Vertrauen folgt. Zudem ist diese Forderung illusorisch, denn, wie der Philosoph Byung-Chul Han es in seinem dünnen Büchlein Infokratie: Digitalisierung und die Krise der Demokratie treffend formuliert: “Die Herrschaft selbst ist nie transparent. Es gibt keine transparente Herrschaft. Die Transparenz ist die Vorderseite eines Prozesses, der sich der Sichtbarkeit entzieht.” (S. 14)
Desmet erwähnt an dieser Stelle nicht, dass es auch viele Physiker gab und gibt, die das anders sehen. Er beruft sich an dieser Stelle auf Werner Heisenberg, Niels Bohr, Edward Lorenz, Max Planck und René Thom, immerhin Giganten ihres Faches, aber eben nicht die einzigen. Wir werden auf dieses Thema aber später zurückkommen.
“Wissenschaftliche Scans und andere Bildgebungen stellten sich als manipuliert heraus, archäologische Artefakte als gefälscht, Klone von Embryos als erfunden; es gab Forscher, die behaupteten, erfolgreich die Haut von Mäusen transplantiert zu haben, aber in Wirklichkeit war der Eingriff nur durch das Einfärben der Haut von Versuchstieren imitiert worden. Wieder andere bastelten aus Schädelstücken von Menschen und Affen selbst ein Missing Link zusammen, ja, manche schienen ihre Untersuchungen gar völlig frei ersonnen zu haben.” (S. 29)
McGilchrist äußert die Vermutung, dass ein Großteil der Wissenschaftler sich “wissenschaftliches Fehlverhalten” (misdemeanour) zumindest in geringfügigem Ausmaß zu Schulden kommen lässt. In einer Umfrage von 3200 Wissenschaftlern gaben dies 33% der Antwortenden zu, wobei nur 45% überhaupt geantwortet hatten — und die Vermutung nahe liegt, dass besonders korrupte Wissenschaftler dies am wenigsten zugeben würden, die tatsächliche Zahl also deutlich höher ist: “even raw self-admission rates … were surprisingly high, and for certain practices, the inferred actual estimates approach 100%, which suggests that these practices may constitute the de facto scientific norm”, zitiert McGilchrist eine Studie (John, Loewenstein & Prelec (2012) “Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling”; m.H.).
Womit nicht gesagt sein soll, dass alle Nachwuchswissenschaftler, auch nicht alle erfolgreichen, auch nicht alle in der Medizin, so ticken.